Burnout betrifft Menschen, im Gesundheitswesen besonders stark. Wir werfen einen allgemeinen Blick auf Symptome und die Behandlung von Burnout und sprechen mit dem Psychologen Georg Hafner über Burnout-Prävention.
Die Kinder in die Schule bringen, in die Praxis fahren, Termine verwalten, Patientinnen und Patienten betreuen, Online-Meetings abhalten, die Unterlagen für einen Vortrag und Instagram-Posts vorbereiten, dann noch schnell die fälligen Rechnungen überweisen, zwischendurch immer wieder die E-Mails und die News auf Social Media checken und dann schnell einkaufen. Auf einmal steht man im Supermarkt vor dem Regal mit den Nudeln und hat das Gefühl, die Zeit würde stillstehen. Es kann doch nicht sein, dass man sich nicht darauf konzentrieren kann, welche Nudeln man braucht? Es ist doch eine ganz einfache Denkaufgabe. Oder doch nicht? Ist das jenes Gefühl, das viele als erstes Anzeichen von Burnout beschreiben?
Solche Tage, To-do-Listen und Momente sind für viele von uns Alltag. Am Ende des Tages fühlt sich der Körper schwer an, der Kopf rauscht vor lauter Gedanken – Warnsignale, die auf Stress, Erschöpfung oder sogar die ersten Symptome eines Burnouts hindeuten können.
Gerade Menschen in Gesundheitsberufen sind besonders gefährdet. Die Verantwortung ist groß, Fehler können je nach Berufsfeld das Leben der Patientinnen und Patienten stark beeinflussen oder mitunter sogar Leben kosten. Gleichzeitig verschärfen Personalmangel, Arbeitsverdichtung und chronischer Stress die Situation. Hinzu kommt, dass viele Betroffene ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellen – aus Pflichtgefühl, Angst, Kolleginnen und Kollegen zusätzlich zu belasten oder weil sie in der Selbstständigkeit weitestgehend auf sich gestellt sind. Die Folge: Erschöpfung, anhaltende psychische Belastungen und gesundheitliche Beschwerden, die nicht selten im Burnout-Syndrom enden – ein ernstzunehmendes, psychisches Gesundheitsproblem. Wer im Gesundheitswesen arbeitet, kümmert sich täglich um die Gesundheit anderer – doch die eigene gerät dabei oft gefährlich weit aus dem Blickfeld.
Wir haben uns die Ursachen für Burnout sowie die typischen Symptome näher angesehen und sprechen mit dem Psychologen und Burnout-Experten Mag. Georg Hafner, MA über Möglichkeiten der Burnout-Prävention für Menschen im Gesundheitswesen.
Was ist Burnout? Definition und Abgrenzung zur Depression
Burnout, oft auch Burnout-Syndrom genannt, beschreibt laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Syndrom, das durch chronischen Stress am Arbeitsplatz entsteht, der nicht erfolgreich verarbeitet wird. Im ICD-11, im Bereich 24 als Punkt QD85, wird Burnout nicht als eigenständige psychische Erkrankung geführt, sondern als arbeitsbezogenes Phänomen. Als typische Merkmale werden von der WHO ein Gefühl tiefer Erschöpfung, eine zunehmende mentale Distanz oder Zynismus gegenüber der eigenen Arbeit sowie eine reduzierte berufliche Leistungsfähigkeit definiert.
Die WHO betont dabei ausdrücklich, dass Burnout keine Krankheit ist, sondern ein Syndrom, das im Kontext von Arbeit auftritt. Damit soll auch eine Abgrenzung zu Depressionen erfolgen, die sämtliche Lebensbereiche betreffen können und mit weiterreichenden Symptomen wie Hoffnungslosigkeit, Schuldgefühlen oder Interessenverlust einhergehen.
Burnout-Syndrom: Kontroverse um Diagnose und Abgrenzung
Die häufige Verwendung des Begriffs „Burnout“ in Medien, Ratgebern und Behandlungsangeboten stößt in Medizin und Wissenschaft immer wieder auf Kritik. Die Entscheidung der WHO, Burnout nicht als Krankheit anzuerkennen, hängt vor allem damit zusammen, dass die Abgrenzung zu anderen psychischen Erkrankungen nicht eindeutig ist. Hinter dem Burnout-Syndrom steckt im Kern die Beobachtung von komplexem menschlichem Verhalten unter Belastung.
Auch die zunehmende Diagnosestellung wird von einigen Fachleuten aus Psychologie und Medizin kritisch gesehen. Aufgrund der Überschneidungen in der Symptomatik mit der psychischen Störung Depression, schlagen einige Fachleute vor, Burnout unter den Terminus „Depression“ zu fassen und als Erschöpfungsdepression zu bezeichnen.
Was ist die Vorstufe von Burnout? Erste Warnsignale erkennen
Bevor es zu einem ausgeprägten Burnout-Syndrom kommt, treten oft erste Warnsignale auf – eine Art Vorstufe. Dazu zählen chronische Müdigkeit, anhaltende Gereiztheit, Konzentrationsprobleme und das Gefühl, den beruflichen Anforderungen nicht mehr gerecht zu werden. Auch erste psychosomatische Beschwerden wie häufigere Kopfschmerzen oder gelegentliche Schlafprobleme können Vorboten sein. Studien zeigen, dass diese frühen Burnout-Symptome ernst genommen werden sollten, da sie sich unbehandelt zu einem vollen Syndrom entwickeln können.
Wie umfassend das Thema unsere Gesellschaft betrifft, zeigt eine Studie des McKinsey Health Institute aus dem Jahr 2023. Laut dieser Erhebung klagte jede und jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland über Burnout-Symptome wie ständige Ermüdung, Konzentrationsprobleme oder Ablehnung gegenüber der eigenen Arbeit. Dabei ist anzumerken, dass wir hierbei vom Arbeitsmarkt im Allgemeinen und noch nicht einmal vom Gesundheitsbereich im Speziellen sprechen.
Burnout-Symptome und -Anzeichen: Psychische, emotionale und körperliche Beschwerden
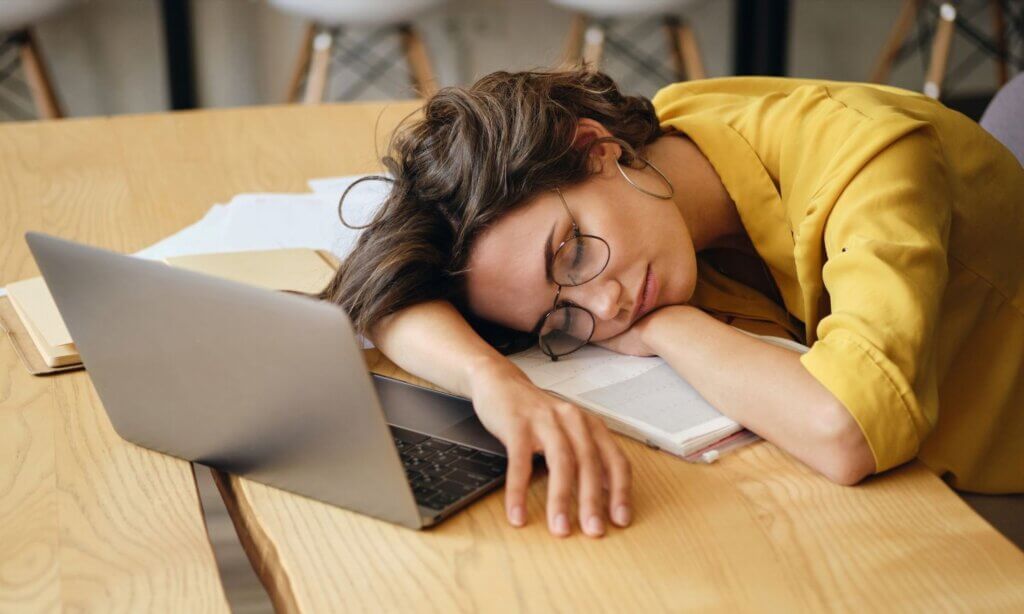
Was sind die Symptome eines Burnouts?
Ein Burnout zeigt sich in einem Zusammenspiel aus psychischen, emotionalen und körperlichen Symptomen. Typisch sind eine anhaltende Erschöpfung, das Gefühl, dauerhaft „ausgebrannt“ zu sein, und eine zunehmende Distanz zur Arbeit. Viele Betroffene berichten von psychischen Symptomen wie Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisproblemen, innerer Unruhe oder einer sinkenden Motivation. Emotionale Beschwerden reichen von Reizbarkeit und Zynismus bis hin zu dem Gefühl, keine Freude mehr am Beruf oder an sozialen Kontakten zu empfinden. Diese Entwicklungen sind Warnsignale, die nicht ignoriert werden sollten.
Wie äußert sich Burnout körperlich?
Burnout ist nicht nur ein psychisches Phänomen, sondern wirkt sich auch auf den Körper aus. Häufige körperliche Beschwerden sind – wie bereits erwähnt – Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Schwindel oder Muskelverspannungen. Viele Betroffene erleben eine dauerhafte Müdigkeit, die sich selbst nach längeren Ruhephasen nicht bessert. Solche somatischen Signale entstehen durch chronischen Stress und verdeutlichen die enge Verbindung zwischen Psyche und Körper — ein zentrales Thema in der Psychosomatik.
Burnout-Symptome bei Frauen und Männern: Unterschiede im Verlauf
Studien zeigen, dass Burnout-Symptome je nach Geschlecht unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Frauen, berichten im Mittel häufiger von emotionaler Erschöpfung und psychosomatischen Beschwerden wie Schlafstörungen, innerer Anspannung oder körperlicher Müdigkeit. Sie neigen zudem öfter zu Perfektionismus und hohen Ansprüchen an die eigene Leistung, was das Risiko für Burnout erhöhen kann. Männer berichten dagegen im Durchschnitt häufiger über emotionale Distanz, Zynismus oder Rückzug aus sozialen Beziehungen.
Die Unterschiede lassen sich nicht allein durch biologische Faktoren erklären. Arbeitsbedingungen und soziale Rollen spielen eine große Rolle: Frauen tragen häufig zusätzlich zur Erwerbsarbeit höhere Belastungen durch unbezahlte Pflege- und Hausarbeit, haben weniger Kontrolle über Arbeitszeiten und sehen sich stärker von gesellschaftlichen Rollenerwartungen beeinflusst. Diese Faktoren können die Intensität der Burnout-Symptome zusätzlich verstärken.
Ergebnisse spezifischer Studien bestätigen diese Muster: In der Untersuchung „Gender differences in burnout among US nurse leaders during COVID‑19 pandemic“ berichteten weibliche Pflegefachkräfte in Führungspositionen über deutlich höhere Werte beim persönlichen Erschöpfungsgefühl, während männliche Führungskräfte höhere Belastungen im Zusammenhang mit Patientinnen und Patienten bzw. Klientinnen und Klienten angaben. In der Studie „Gender differences in psychological morbidity, burnout, job stress and job satisfaction among Chinese neurologists“ zeigten sich ähnliche Befunde: Frauen wiesen höhere Werte bei emotionaler Erschöpfung auf, Männer berichteten stärker über geringere Arbeitszufriedenheit.
Darüber hinaus beeinflusst auch die Messung von Burnout die wahrgenommenen Unterschiede: Ob Burnout über standardisierte Fragebögen, einzelne Items oder subjektive Selbstauskünfte erfasst wird, kann die Höhe und Art der Symptomberichte verändern. Studien zeigen, dass geschlechtsspezifische Unterschiede besonders in einzelnen Items wie Erschöpfung konsistenter auftreten als im Gesamt-Burnout-Score.
Woher weiß ich, ob ich Burnout habe?
Die Diagnose Burnout wird in der Regel von Fachärztinnen und -ärzten oder Psychotherapeutinnen und -therapeuten gestellt. Es gibt keinen Bluttest oder medizinischen Wert, der Burnout eindeutig nachweisen kann. Stattdessen werden ausführliche Gespräche, standardisierte Fragebögen und die Abgrenzung zu anderen psychischen Erkrankungen — insbesondere Depression — herangezogen. Wer über längere Zeit unter starker Erschöpfung, psychischen Symptomen und körperlichen Beschwerden leidet, sollte daher unbedingt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Eine frühzeitige Abklärung kann verhindern, dass sich ein akutes Burnout-Syndrom entwickelt.
Nur noch kurz die Welt retten: Ursachen für Burnout im Gesundheitswesen
Das Gesundheitswesen zählt zu den Bereichen mit dem höchsten Risiko für Burnout. Menschen, die in Bereichen wie Medizin, Pflege und Therapie tätig sind, sind oftmals besonders stark belastet, da die Kombination aus emotionaler Arbeit, Personalmangel, langen Arbeitszeiten und hoher Verantwortung zu einer erhöhten Vulnerabilität für Burnout führt.
Belastungen im Gesundheitswesen: Personalmangel, Überlastung und Verantwortung
Eine Studie der Ärztekammer für Wien zeigt, dass mehr als die Hälfte der befragten Spitalsärztinnen und -ärzte häufig oder dauerhaft unter körperlicher und emotionaler Erschöpfung leiden. Auch Pflegekräfte sind betroffen: Laut einer Erhebung der Gewerkschaft GPA, in Kooperation mit der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA), geben 65 Prozent der Befragten an, dass sie es für unwahrscheinlich halten, ihren Beruf bis zur Pension auszuüben, und 15 Prozent haben bereits konkrete Absichten, den Tätigkeitsbereich oder den ganzen Beruf zu wechseln.
Burnout und Selbstständigkeit: Herausforderungen für TherapeutInnen
Selbstständige Therapeutinnen und -therapeuten stehen vor besonderen Herausforderungen: Sie sind nicht nur für die therapeutische Arbeit verantwortlich, sondern auch für die Praxisorganisation, Akquise von Klientinnen und Klienten und administrative Aufgaben. Diese Mehrfachbelastung kann zu emotionaler Erschöpfung, Depersonalisation und verringerter Leistungsfähigkeit führen.
Eine Studie des Klaus-Grawe-Instituts weist beispielsweise darauf hin, dass Burnout als häufigste Ursache der Berufsunfähigkeit von Psychotherapeutinnen und -therapeuten betrachtet wird und das obwohl Psychotherapeutinnen und -therapeuten in Befragungen meist eine hohe berufliche Zufriedenheit angeben.
Im Psychotherapeutenberuf spielen vor allem die therapeutische Beziehung und inhaltliche Aspekte eine zentrale Rolle: Therapeutinnen und Therapeuten sind als ganze Person in die Arbeit eingebunden und tragen die Verantwortung für den Behandlungserfolg. Sie werden häufig mit Leid, schweren Symptomen und Suizidalität konfrontiert. Zusätzlich erschweren manchmal unrealistische Heilserwartungen oder schwieriges Verhalten von Patientinnen und Patienten (z. B. Aggression oder Manipulation) die Arbeit.
Burnout-Prävention im Gesundheitswesen: Im Interview mit Psychologe und BÖP-Vorstandsmitglied Georg Hafner
Wie die Studie zu Burnout bei Psychotherapeutinnen und -therapeuten verdeutlicht, zeigt sich gerade im Gesundheitswesen ein Paradoxon: Wer täglich die psychische und körperliche Gesundheit anderer Menschen unterstützt, vergisst oft die eigene Gesundheit. „Nur weil man weiß, wie es für andere gehen würde, heißt das noch lange nicht, dass man diese Methoden auch für sich selbst gut anwenden kann“, sagt Mag. Georg Hafner, MA. Ein Trugschluss, der bei vielen Ärztinnen und Ärzten, Pflegekräften und Therapeutinnen und Therapeuten die Gefahr von Erschöpfung, Überlastung und Burnout erhöht.

Hafner ist Klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe sowie zertifizierter Arbeits- und Organisationspsychologe. Er studierte Psychologie an der Universität Wien mit den Schwerpunkten Gesundheits- und Arbeitspsychologie und beschäftigte sich in seiner Diplomarbeit mit dem Umgang mit Stress. Neben seiner Tätigkeit als Sportpsychologe und Mentaltrainer engagiert er sich heute als Vorstandsmitglied im Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) und gilt als ausgewiesener Experte für Burnout-Prävention im Gesundheitswesen.
Wir haben mit ihm über die Ursachen von Burnout, typische Warnsignale und vor allem über Möglichkeiten der Prävention gesprochen – gerade für Menschen, die in Gesundheitsberufen tätig sind.
Welche ersten Anzeichen für ein Burnout sollten Betroffene bei sich selbst ernst nehmen?
Im besten Fall spricht man schon mit jemandem darüber, bevor man Burnout bekommt. Jeder Mensch hat unterschiedliche Warnsignale. Wenn ich mir erst bei Warnsignal Nummer 7 Hilfe und Unterstützung suche, braucht es viel mehr seitens der Psychologie und Medizin, um einem Burnout entgegenzuwirken.
Wenn ich aber bereits beim zweiten oder dritten Warnsignal auf meinen Körper höre und gegensteuere, kommt es vielleicht gar nicht erst zu einem Burnout.
Diese frühen Warnsignale können Kleinigkeiten sein: beispielsweise häufigere Kopfschmerzen als üblich, verstärkte Unkonzentriertheit, Schlafprobleme oder auch Magen-Darm-Beschwerden. Ein Gefühl von emotionaler Erschöpfung in Richtung innerer Leere ist bereits ein starkes Warnsignal. Gerade bei Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, ist es oftmals der Einsatz von Zynismus, der einem dann gegebenenfalls auch mal von den Kolleginnen und Kollegen rückgemeldet wird. Generell fällt einem vielleicht auch auf, dass man immer mehr Aufwand betreiben muss und trotzdem die Leistung mehr und mehr abfällt.
Warum sind gerade Menschen in Gesundheitsberufen besonders anfällig für Burnout?
Menschen in Gesundheitsberufen sind für andere da. Das heißt, sie sind sehr offen gegenüber anderen Menschen, oftmals besonders empathisch, leiden dementsprechend aber auch oft sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer oder sozialer Ebene mit den Patientinnen und Patienten mit. Bei vielen kommt zu den psychischen Herausforderungen im Arbeitsalltag auch noch eine Persönlichkeitsstruktur hinzu, die dafür sorgt, dass ihre persönlichen Bedürfnisse auch im privaten Umfeld immer erst nach denen der Anderen kommen.
Gerade im Gesundheitsbereich wird diese Offenheit von Patientinnen und Patienten auch sehr gerne angenommen, beispielsweise bei einer Pflegekraft, in der Physiotherapie oder bei der Heilmassage: Nicht nur von den aktuellen gesundheitlichen Problemen wird erzählt, sondern mitunter die gesamte Lebensgeschichte mitgeteilt. Die Patientinnen und Patienten sind in diesem Augenblick vulnerabel und öffnen sich, während die Therapeutinnen und Therapeuten, Pflegerinnen und Pfleger oder Ärztinnen und Ärzte gerne ein offenes Ohr leihen.
Menschen in Gesundheitsberufen haben also eine hohe emotionale Belastung, weil sie so viele Details der Lebensumstände der Menschen mitbekommen und gleichzeitig einen hohen Verantwortungsdruck spüren.
Eine therapeutische oder medizinische Entscheidung kann mitunter weitreichende Folgen und Auswirkungen auf das Leben von Patientinnen und Patienten haben.
Zeit- und Termindruck ist ein weiterer großer Stressfaktor bei Menschen in Gesundheitsberufen. Sei es die Hauspflegekraft, deren dicht getakteter Plan durch einen kleinen Verkehrsstau über den Haufen geworfen wird, oder die selbstständigen Therapeutinnen und Therapeuten, die oftmals alleine für sich alle Aufgabenpakete ihres Praxisalltags abdecken und bewältigen müssen – von Patientenbetreuung über Buchhaltung bis hin zu Marketing.
Burnout ist nicht nur ein individuelles, sondern auch ein strukturelles Problem. Was müsste sich in Krankenhäusern, Praxen oder im Gesundheitssystem generell ändern, um Burnout vorzubeugen?
Ich selbst halte oft Seminare zum Thema „Gesundes Führen“ – das ist in allen Branchen wichtig, aber vor allem im Gesundheitswesen. Bei diesen Schulungen geht es unter anderem darum, dass die Führungskraft bei sich selbst beginnt, ein Bewusstsein für die eigene Gesundheit entwickelt und in weiterer Folge für eine gesunde Arbeitskultur einsteht.
Je „gesünder“ eine Struktur ist – sowohl auf psychischer als auch auf physischer Ebene –, desto produktiver ist sie auch.
Was lebt die Führungskraft vor? Darf Überforderung angesprochen werden? Gibt es eine ehrliche Fehlerkultur? Darf Kritik an bestehenden Systemen und Abläufen geübt werden? Führungskräfte im Gesundheitswesen tragen nicht nur zur Gesundheit der Mitarbeitenden bei, sondern auch zu hunderten Leben, die in weiterer Folge dadurch mit beeinflusst werden.
Ein weiterer Punkt ist leider das Verknappungsprinzip, das in vielen Bereichen des Gesundheitswesens vorherrscht. Vieles wird immer weiter getaktet und skaliert. Das funktioniert in der Regel halbwegs, solange keiner auf Urlaub geht oder krank wird. Wenn alles zusammenkommt bzw. längere Krankenstände hinzukommen, überhäufen sich die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann noch im Arbeitsbetrieb verbleiben. Dies setzt einen negativen Kreislauf in Gang, da aufgrund der oftmals dauerhaften Belastung weitere lange Krankenstände hinzukommen. Es sollten im besten Fall die Arbeitszeiten und deren Belastungen so gestaltet werden, dass die Arbeit auch bei Ausfällen (Urlaub, Krankenstände etc.) gut gemeistert werden kann.
Ein dritter Punkt, der meinem Eindruck nach einen viel zu geringen Stellenwert hat, ist der Einsatz von Supervision und Intervision.
Diese werden sehr oft ausgespart, der Sinn abgesprochen und als zu großer Kostenpunkt begründet. Dabei ist Supervision, welche ich sehr gerne anbiete, aber auch selber nutze, ein enorm wichtiger Beitrag zur psychischen Entlastung. Manchmal nur zwecks Psychohygiene, damit man gewisse Themen einmal aussprechen und „abladen“ kann, aber sehr oft auch zur Verbesserung einer Struktur und der Zusammenarbeit. Wenn man einen Schritt weitergeht: Das Selbstverständnis der Arbeitspsychologie müsste noch viel mehr gelebt werden. In vielen Unternehmen ist es (noch) notwendig, arbeitspsychologische Sprechstunden „schön“ zu verpacken, etwa als Work-Life-Balance und Stressmanagement, um zu etikettieren, damit eine gesellschaftliche Hürde – der Weg zur Psychologie – leichter machbar ist. Der Nutzen solcher Beratungsgespräche ist meiner langjährigen Erfahrung nach von enormem Wert.
Hier kommt sicher wieder ein Punkt ins Spiel, den Sie schon angesprochen haben: Bei vielen ist eine Hemmschwelle da, zu äußern, dass sie überfordert sind, oder die Angst, dass es negativ auf einen zurückfällt, wenn man Kritik übt.
Hier zeigt sich, wie wichtig die Haltung einer Führungskraft ist. Ist ein offenes Ansprechen einer Überforderung erwünscht und erlaubt? Wie wird ein Angebot der Arbeitspsychologie präsentiert? Kurzer Exkurs in die Sportpsychologie: Wenn ein Trainer seiner Mannschaft erklärt, dass es wichtig ist, zum Sportpsychologen zu gehen und es ein enorm wichtiger Teil des Erfolges ist, wird das Angebot anders wahrgenommen, als wenn gesagt wird: „Es ist unnötig, aber es ist nun mal Vorschrift, dorthin zu gehen.“ Wenn die Führungsebene es vorlebt und selbst regelmäßig arbeitspsychologisches Coaching für sich nutzt, hat das einen enormen positiven Impact. Dann fällt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leichter, die Arbeitspsychologie zum Beispiel für den Umgang mit Stressbewältigung zu nutzen.
Welche Strategien oder Alltagsroutinen können TherapeutInnen konkret nutzen, um ihre psychische Gesundheit zu schützen?
In erster Linie ist es wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen. Nehmen wir das Wort „Selbstbewusstsein“ her: Ich bin mir meiner selbst bewusst. Das kann heißen: „Ich bin gerade überfordert“ oder „Mir geht es gerade nicht gut.“ Es ist im Alltag immer wieder wichtig, zur Ruhe zu kommen. Das können zwei, drei Sekunden sein. Die Augen schließen und hineinspüren: Wie geht es mir gerade? Bin ich mir meiner aktuellen Bedürfnisse bewusst? Bin ich durstig oder müde? Welche kleinen Dinge brauche ich jetzt, um wieder leistungsfähiger zu werden? Dazu gehört eine regelmäßige Pausenkultur. Zwischendurch einfach mal die Augen schließen für zwei Minuten.
Ein anderer wichtiger Punkt ist es, klare Grenzen zu setzen. Bis hierher helfe ich, bis hierher unterstütze ich, bis hierher entspricht es meinem Energielevel, aber nicht weiter.
Hier kommt auch das Bewusstwerden ins Spiel: Ist mir bewusst, wie weit ich gehen kann? Das Ganze geht wieder einher mit Selbstreflexion und Supervision. Manchen fällt es leicht, sich selbst zu reflektieren, andere brauchen diese Impulse immer wieder von außen.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind Fortbildungen. Wer sich in seiner Arbeit sicher fühlt und auf dem neuesten Stand ist und Qualität anbietet, kann nicht nur den Beruf gut ausführen, sondern fühlt sich auch selbstsicherer und entspannter.
Nicht nur die fachliche Weiterbildung, auch Fortbildung zu den Themen Selbstfürsorge oder Psychohygiene ist sicher hilfreich. Gerade wenn man als Therapeutin oder Therapeut in die Selbstständigkeit startet.
Genau, das ist nämlich auch oft ein Trugschluss: Nur weil ich weiß, wie es für andere gehen würde, weil ich Menschen therapiere, betreue oder pflege, heißt das noch lange nicht, dass ich diese Methoden für mich selbst gut anwenden kann. Zu Beginn einer Selbstständigkeit, wenn die Motivation hoch ist und auch der finanzielle Druck enorm, bis die Klientinnen und Klienten aufgebaut sind, ist Selbstfürsorge sehr hilfreich, weil oftmals eine Überforderung droht. Diese Themen kommen immer wieder bei meinen Einzelberatungen.
Sie haben das Thema schon kurz angesprochen: Welche Rolle spielen die Teamkultur und der offene Austausch über Belastungen in der Burnout-Prävention? Viele Menschen haben ja auch unter Kolleginnen und Kollegen Hemmungen, sich einander anzuvertrauen, weil auch hier manchmal die Angst herrscht, dass etwas gegen einen verwendet wird.
Es ist auch verständlich, dass viele skeptisch sind und nicht das komplette Privatleben ausbreiten wollen oder nicht alle überfordernden Situationen geradeheraus kommunizieren. Wie so oft im Leben ist es auch hier ein Balanceakt, abzuschätzen, wem ich wie viel anvertrauen kann.
Auch hier sind oftmals wieder die Führungsebenen gefragt, ein offenes Teamklima zu schaffen, in dem niemand ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl haben muss, Überforderung intern zu kommunizieren.
In einem gut geleiteten und organisierten Team ist es oft möglich, Ressourcen kurzfristig umzuverteilen, wenn beispielsweise jemand ausfällt, die eigenen Agenden einen gerade überrollen oder private Themen zu viel Aufmerksamkeit binden.
Wenn Sie Beschäftigten im Gesundheitswesen drei essentielle, kurze Tipps zur Burnout-Prävention geben könnten – welche wären das?
Ich lehne die drei Punkte an das Bio-Psycho-Soziale Modell an.
- Die Selbstreflexion anwenden und das eigene psychische Energielevel beachten, eine Pausenkultur etablieren und einen inneren Ausgleich schaffen.
- Sein soziales Netz als Ressource nutzen – sei es beruflich, privat und/oder eben in Form von Supervision oder der Arbeitspsychologie.
- Die Bedürfnisse des Körpers achten, Bewegung im Berufsalltag integrieren und auf regelmäßige Aktivität achten, welche wiederum Stress abbaut und einfach gut tut. Sowohl dem Körper als auch der Seele.
Fortbildung in Sachen Selbstfürsorge: Die Angebote der ÖAP
Die Österreichische Akademie für Psychologie (ÖAP), die Fortbildungsakademie des BÖP, bietet regelmäßig Vorträge und Fortbildungen zum Thema Selbstfürsorge und Burnout-Prävention an. Wir habe einige für dich zusammengesucht:
- 11. Oktober 2025
Selbstbild und Selbstwert – Methodenkoffer für die Praxis und Selbsterkenntnis – vertiefender Workshop zu Selbstbild und Selbstwert Tools für die Praxis - 14. und 15. Oktober 2025
Psychohygiene und Burnoutprophylaxe für PsychologInnen und PsychotherapeutInnen auf Grundlage einer schematherapeutischen Perspektive & Selbsterfahrung - 04. Dezember 2025
Webinar: Psychohygiene und Selbstfürsorge – praktisch angewandt
Am 23. Januar 2026 findet zudem eine Tagung zum Themenbereich Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologie in Wien statt. Weitere Infos zu dieser Veranstaltung folgen auf der Website des BÖP.
In unserem Themenbereich Bildung & Events halten wir dich laufend auf dem neuesten Stand zu Fortbildungen, Seminaren und Tagungen zu den unterschiedlichsten therapeutischen Fachrichtungen – mit dabei sind auch immer wieder Vorträge und Weiterbildungen zu Selbstfürsorge, Burnout-Prävention und Stressbewältigung.
Wege aus dem Burnout: Hilfe finden und Behandlungsmöglichkeiten
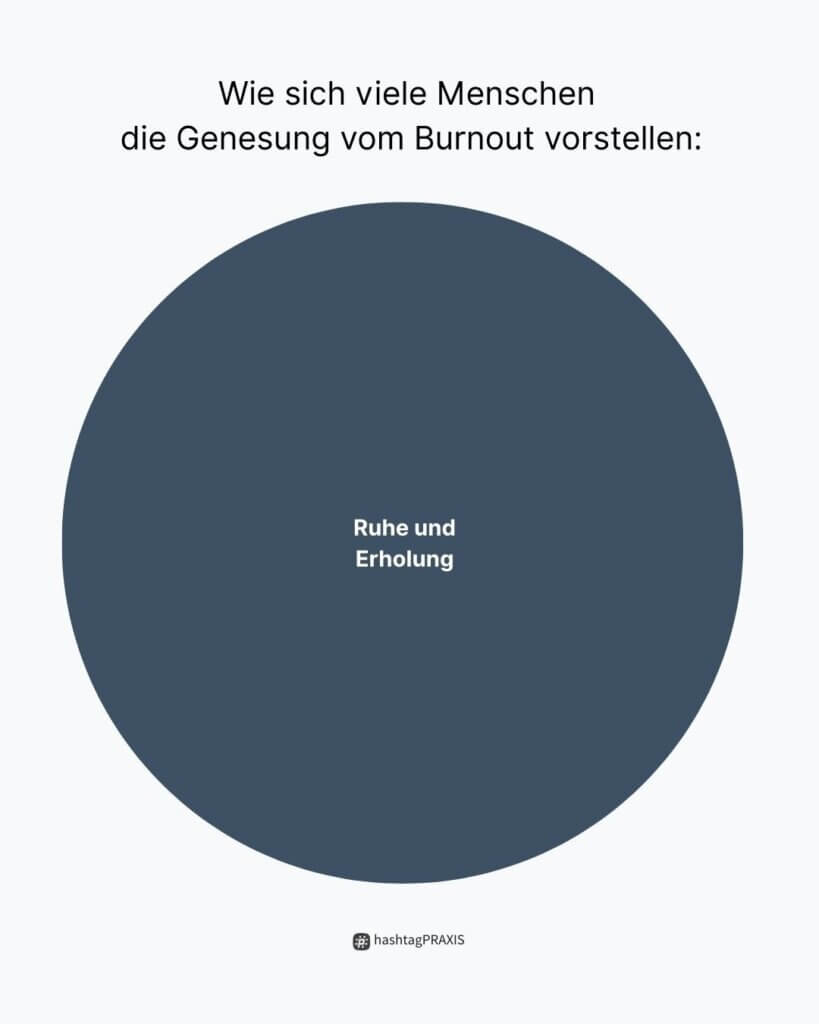

Burnout-Prävention ist der beste Weg, um Überlastung, Erschöpfung und psychische Beschwerden gar nicht erst entstehen zu lassen. Doch was tun, wenn es bereits zu spät ist und die Symptome so stark sind, dass der Alltag kaum noch zu bewältigen ist? Wichtig ist zu wissen: Hilfe ist möglich, und es gibt bewährte Behandlungsmethoden, um aus dem Burnout wieder herauszufinden.
Der erste Schritt besteht darin, die Ursachen zu erkennen. Oft ist es eine Kombination aus chronischem Stress, hohen beruflichen Belastungen und dem Vernachlässigen eigener Bedürfnisse. Eine frühzeitige Diagnose durch Fachärztinnen und -ärzte oder Psychotherapeutinnen und -therapeuten ist entscheidend, um passende Behandlungsmöglichkeiten einzuleiten.
Zu den zentralen Therapieformen zählen die Psychotherapie und die Psychologische Beratung. In Gesprächen mit qualifizierten Therapeutinnen und Therapeuten oder Psychologinnen und Psychologen können Betroffene lernen, Stressmuster zu durchbrechen, neue Strategien im Umgang mit Belastungen zu entwickeln und Ressourcen zu stärken. Ergänzend können arbeitspsychologische Maßnahmen – etwa Veränderungen in der Arbeitsorganisation oder die Reduktion von Überstunden – ein wichtiger Teil der Behandlung sein.
Auch körperorientierte Ansätze haben ihren Platz: Bewegung, Entspannungsverfahren wie Achtsamkeitstraining oder Yoga sowie eine gesunde Schlaf- und Ernährungspraxis unterstützen den Heilungsprozess. In manchen Fällen kann eine medizinische Behandlung mit Medikamenten notwendig sein, etwa wenn Burnout mit einer Depression einhergeht.
Entscheidend ist, nicht allein zu bleiben. Wer nach professioneller Unterstützung sucht, findet Hilfe bei Psychotherapeutinnen und -therapeuten, Fachärztinnen und -ärzten für Psychiatrie oder Psychologinnen und Psychologen. Dort lassen sich qualifizierte Expertinnen und Experten finden, die auf Burnout und verwandte psychische Erkrankungen spezialisiert sind.
Über das Verzeichnis von psychonline.at findet man unter dem Themenbereich „Burnout / Burnout-Vorbeugung“ nach Bundesländern sortiert passende Psychotherapeutinnen und -therapeuten für diesen Fachbereich in Österreich. Psychologinnen und Psychologen, die auf das Thema Burnout spezialisiert sind, sind im Verzeichnis von psychnet.at zu finden. Für Deutschland bietet der Bundesverband Burnout und Depression e.V. einen guten Überblick über alle Verzeichnisse – bundeslandspezifisch und national – über die man passende Psychotherapeutinnen und -therapeuten findet. Über das Psychologenportal des BDP können unter Angabe der Postleitzahl und des Stichworts „Burnout“ die passenden Psychologinnen und Psychologen in der Nähe gefunden werden.
Burnout ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eine ernstzunehmende Folge dauerhafter Überlastung. Mit der richtigen Behandlung und durchdachten Präventionsstrategien ist es möglich, wieder zu mehr Gesundheit, Lebensqualität und innerer Balance zurückzufinden.
Header © wayhomestudio | Freepik





