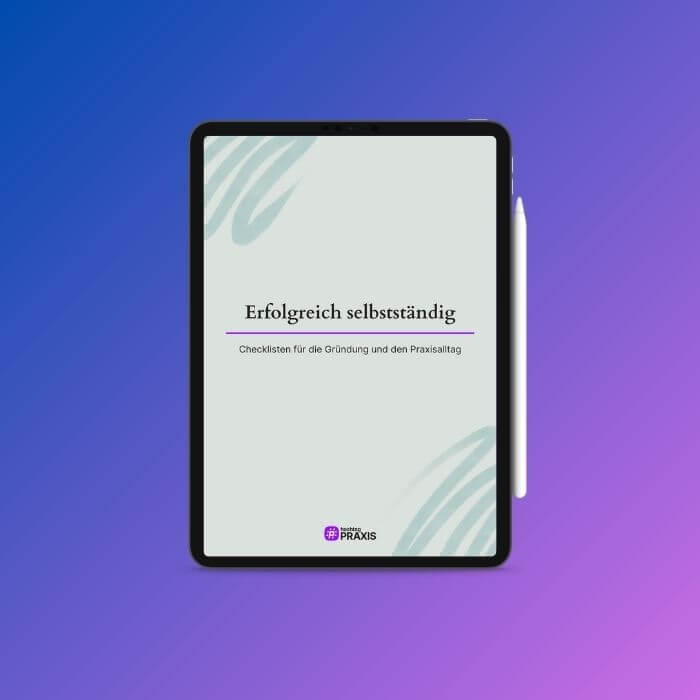Praxisgemeinschaft oder Gemeinschaftspraxis? Unterschiede, Vorteile und Nachteile für Therapeutinnen und Therapeuten in Deutschland und Österreich kompakt erklärt.
Sie klingen ähnlich, bezeichnen aber dennoch zwei unterschiedliche Arten der Praxisführung: die Gemeinschaftspraxis und die Praxisgemeinschaft. Sich als Therapeutinnen und Therapeuten zusammenzuschließen, kann viele Vorteile bringen. Man kann nicht nur Kosten und Marketingaufwand sparen, auch die Patientinnen und Patienten profitieren vom Austausch sowie der direkten Weiterleitung an Expertinnen und Experten anderer Fachrichtungen innerhalb der Praxis.
Wir haben uns für dich angesehen, wo die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede dieser beiden Praxisformen liegen und welche Vor- und Nachteile sie bringen.
Inhalt
Gemeinschaftspraxis: Therapeutische Einheit
In einer Gemeinschaftspraxis – in Deutschland auch als „Berufsausübungsgemeinschaft“ (BAG) bezeichnet – schließen sich mehrere Therapeutinnen und Therapeuten zusammen, um nicht nur unter einem gemeinsamen Dach zu arbeiten, sondern auch wirtschaftlich, organisatorisch und rechtlich eng miteinander verbunden zu sein. Dabei teilen sie sich nicht nur Räumlichkeiten, Einrichtung, medizinische Geräte und Personal wie etwa medizinische Fachangestellte oder Empfangskräfte, sondern auch den PatientInnen-Stamm sowie die PatientInnen-Akten.
Wirtschaftlich agieren sie als Einheit: Einnahmen und Ausgaben werden gemeinsam verwaltet, Investitionen gemeinsam getragen, und auch die Abrechnung – etwa mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Deutschland oder mit den Sozialversicherungsträgern in Österreich – erfolgt unter einer gemeinsamen Abrechnungsnummer. In der Regel haften alle Beteiligten gemeinschaftlich, insbesondere wenn sie sich für die Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) oder, je nach Konstellation, eine Partnerschaftsgesellschaft (PartG) entscheiden.
Neben der klassischen örtlichen Gemeinschaftspraxis existieren in Deutschland auch überörtliche Modelle, bei denen mehrere Standorte betrieben werden, sowie sogenannte Teil-Berufsausübungsgemeinschaften (Teil-BAG), bei denen nur bestimmte Bereiche gemeinschaftlich geführt werden. In Österreich entspricht diesem Modell die sogenannte Gruppenpraxis, wie sie für Medizinerinnen und Mediziner im § 52a des Ärztegesetzes geregelt ist. Diese tritt als eigene juristische Person auf – etwa als Offene Gesellschaft (OG) oder GmbH. Therapeutinnen und Therapeuten – vor allem Psychotherapeutinnen und -therapeuten und klinische Psychologinnen und Psychologen – können eine Gruppenpraxis gründen, sofern sie bestimmte berufsrechtliche Voraussetzungen und vertragliche Bedingungen mit den Sozialversicherungsträgern erfüllen.
Ob in Deutschland oder Österreich: Die Gemeinschafts- bzw. Gruppenpraxis ist eine vollständige rechtliche Einheit. Alle Beteiligten arbeiten innerhalb eines gemeinsamen Unternehmens, teilen Verantwortung, Rechte und Pflichten und tragen die unternehmerischen Risiken – profitieren jedoch ebenso gemeinsam von den Chancen, die eine eng abgestimmte Zusammenarbeit mit sich bringt.
Du überlegst eine Gemeinschafts- oder Gruppenpraxis zu gründen bzw. darin mitzuarbeiten? Wir haben zehn wichtige Punkte, die du dabei im Blick haben solltest, für dich zusammengefasst!
Praxisgemeinschaft: Zusammen eigenständig
In einer Praxisgemeinschaft schließen sich mehrere Therapeutinnen und Therapeuten – mit gleichem oder unterschiedlichem Fachhintergrund – zusammen, um bestimmte organisatorische Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Meist teilen sie sich Praxisräume, Ausstattung und manchmal auch Personal wie Empfangskräfte oder Verwaltung. Die therapeutische Arbeit selbst erfolgt jedoch unabhängig: Jede Therapeutin und jeder Therapeut führt eine eigene Praxis, behandelt eigenständig Patientinnen und Patienten und tritt unter dem eigenen Namen auf. Auch PatientInnen-Stamm und -Akten werden strikt getrennt geführt. Die Abrechnung mit den Krankenkassen erfolgt individuell, und jede Praxis wirtschaftet für sich. Das bedeutet: Es gibt keine gemeinsame Kasse, keine geteilten Einnahmen oder Ausgaben. Ebenso haftet jede Therapeutin und jeder Therapeut nur für die eigene Praxis.
Zusammengefasst: Eine Praxisgemeinschaft ist eine Form der Zusammenarbeit, bei der Therapeutinnen und Therapeuten zwar organisatorisch unter einem Dach arbeiten, rechtlich und wirtschaftlich jedoch vollkommen eigenständig bleiben. Aus juristischer Sicht handelt es sich um mehrere voneinander unabhängige Praxen, die lediglich bestimmte Ressourcen gemeinsam nutzen. Jede und jeder trägt das eigene unternehmerische Risiko.
Gemeinschaftspraxis oder Praxisgemeinschaft: Vorteile und Nachteile im Vergleich
Beide Modelle bringen unterschiedliche Chancen und Herausforderungen mit sich. Die Wahl hängt vor allem davon ab, wie eng Therapeut:innen zusammenarbeiten möchten – organisatorisch, wirtschaftlich und rechtlich. Ein Überblick über zentrale Vor- und Nachteile hilft bei der Entscheidungsfindung:
Vorteile einer Praxisgemeinschaft
- Hohe Eigenständigkeit: Jede Therapeutin und jeder Therapeut arbeitet unabhängig mit eigenen Patientinnen und Patienten und eigenen Entscheidungen.
- Kostenersparnis: Gemeinsame Nutzung von Räumen, Geräten, Empfang oder Verwaltungspersonal reduziert Fixkosten.
- Flexible Gestaltung: Keine Genehmigung oder Gesellschaftsvertrag notwendig – unkomplizierte Gründung und leichtere Auflösung.
- Vertretungsmöglichkeiten: Therapeutinnen und Therapeuten gleicher Fachrichtung können sich gegenseitig vertreten.
- Fachlicher Austausch: Bei unterschiedlichen Schwerpunkten kann ein internes Überweisungssystem aufgebaut werden.
- Keine gesamtschuldnerische Haftung: Jede und jeder haftet nur für die eigene Praxis.
Nachteile einer Praxisgemeinschaft
- Getrennte Abrechnung: Abrechnung mit Kassen oder privat muss separat erfolgen – organisatorisch aufwändiger.
- Mehr Verwaltungsaufwand: Eigene PatientInnen-Akten, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Datenschutzvorkehrungen etc.
- Eingeschränkte Einsicht: PatientInnen-Unterlagen dürfen nicht ohne Einwilligung geteilt werden.
- Alleinige Verantwortung: Wirtschaftliches Risiko und Haftung liegen bei jeder Praxis selbst.
- Steuerliches Risiko: Bei falsch geregeltem Ressourcenteilen kann Umsatzsteuerpflicht entstehen.
Vorteile einer Gemeinschaftspraxis
- Gemeinsame Organisation: Verwaltung, Abrechnung, PatientInnen-Führung und Praxisabläufe werden effizient zusammengelegt.
- Kostenvorteile durch Integration: Einnahmen und Ausgaben fließen in einen gemeinsamen Topf – ideal bei starker Zusammenarbeit.
- Bessere Planbarkeit: Gemeinsame Investitionen, gemeinsame Entscheidungen, geteilte Verantwortung.
- Vertretung ohne Einschränkungen: Alle Beteiligten haben Zugriff auf denselben PatientInnen-Stamm und die gemeinsame Dokumentation.
Nachteile einer Gemeinschaftspraxis
- Geringere individuelle Freiheit: Entscheidungen müssen gemeinsam getroffen werden – das schränkt Unabhängigkeit ein.
- Langfristige Bindung: Die Zusammenarbeit erfordert hohe persönliche und fachliche Kompatibilität.
- Gesellschaftsvertrag nötig: Oft komplexer Regelungsbedarf (Investitionen, Arbeitsverteilung, Ausstieg etc.).
- Gesamtschuldnerische Haftung: Bei bestimmten Rechtsformen (z. B. GbR) haften alle für Fehler oder Schulden der anderen.
Unser Newsletter für dich
Schon angemeldet? Im hashtagPRAXIS Newsletter bekommst du monatlich frische Tipps, Impulse und Ressourcen für deinen Praxisalltag. 💡 Als Dankeschön erhältst du ein kostenloses eBook mit Checklisten für Praxisgründung und Praxisjahr!
Header © Freepik