Die Planetary Health Konferenz 2025 bot praxisnahe Einblicke zu Klimaresilienz, Umweltmigration und nachhaltiger Gesundheitsversorgung. Wir haben die Inhalte für dich umfangreich aufbereitet – zum Nachlesen oder für alle, die diesmal nicht live dabei sein konnten.
Am 18. September wurde die erste Planetary Health Konferenz am Campus Pinkafeld der Hochschule Burgenland offiziell eröffnet. Nach einem vorbereitenden Vortag am 17. September begrüßte Erwin Gollner, Departmentleiter für Gesundheit und Soziales, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Er betonte, dass gerade der Standort selbst für das Thema stehe: Mit dem derzeit entstehenden grünen Campus, geplant von Pichler/Traupmann Architektur und für 2026 angekündigt, will die Hochschule ein sichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit setzen.
Univ.-Prof. Dr. Stephan Kriwanek, medizinischer Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland, richtete den Blick unmittelbar auf die Praxis: Krankenhäuser seien auf die Folgen des Klimawandels noch unzureichend vorbereitet. Schon heute führe extreme Hitze dazu, dass Eingriffe im Sommer nicht mehr wie gewohnt möglich seien – etwa Gipsverbände, die unter hohen Temperaturen problematisch werden. Auch Patientinnen und Patienten litten bereits spürbar unter den Auswirkungen, während Krankenhäuser zugleich selbst Verursacher von Emissionen sind, etwa durch den Einsatz von Lachgas, einem besonders klimaschädlichen Treibhausgas. Sein Appell: Gesundheitsversorgung müsse nicht nur widerstandsfähiger gegen Klimafolgen werden, sondern auch ihre eigene Umweltbilanz verbessern.
Unterstützt wurde die Konferenz von zahlreichen Partnern, darunter die Gesundheit Österreich GmbH (GÖK), das Land Burgenland, die Arbeitsgemeinschaft Krankenhausmanager, der Fonds Gesundes Österreich sowie die Österreichische Gesellschaft für Public Health. Auch organisatorisch war das Treffen konsequent nachhaltig ausgerichtet: Die Veranstaltung wurde als Green Meeting nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens zertifiziert – organisiert durch den Österreichischen Verband Grüner Krankenhäuser. Dieses Umweltzeichen ist das erste nationale Gütesiegel, das die Zertifizierung einer gesamten Veranstaltung ermöglicht.
Damit wollte die Hochschule nicht nur ein Signal setzen, sondern auch Verantwortung übernehmen: Konferenzen haben immer einen spürbaren ökologischen Fußabdruck, und genau hier liegt ein Hebel für Veränderung. Mit der Entscheidung für ein Green Meeting sollte die Konferenz nicht nur einen positiven Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch zur regionalen Wertschöpfung und zur sozialen Verantwortung leisten. Das Ziel war klar: eine nachhaltige, qualitativ hochwertige Veranstaltung, die inhaltlich wie organisatorisch die Idee der Planetary Health konsequent mitträgt.
Wenn du mehr zu den einzelnen Keynotes, Break-Out-Sessions und Posterwalks lesen möchtest: Einfach links oben beim jeweiligen Textabschnitt auf den Pfeil klicken und die vollständige Info ausklappen!
Keynote | Gesundheit in der Klimakrise oder die Chancen einer tiefgreifenden Transformation für Gesundheitsförderung und mehr soziale Gerechtigkeit
Willi Haas, BOKU University
Hans-Peter Hutter, Medizinische Universität Wien

In ihrer Eröffnungs-Keynote machten Willi Haas (BOKU) und Hans-Peter Hutter (MedUni Wien) deutlich, dass die Klimakrise nicht nur eine ökologische, sondern zunehmend auch eine gesundheitliche Krise ist. Extreme Wetterereignisse, steigende Temperaturen, Luftverschmutzung, Biodiversitätsverlust oder veränderte Krankheitsmuster wirken sich unmittelbar auf die Gesundheit der Bevölkerung aus. Hinzu kommen gesellschaftliche Entwicklungen wie Urbanisierung, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung. Dennoch dominiert im Gesundheitssystem weiterhin ein kurativer Überhang: Prävention steht in der Ausbildung wie in der Praxis weit hinten, während die technikgetriebene Akutmedizin über stärkere Lobbys und sichtbarere Erfolge verfügt. (weiterlesen…)
Besonders problematisch ist die soziale Dimension: Menschen mit niedrigerem Einkommen leben häufiger in belasteten Umwelten und haben schlechteren Zugang zu Grünräumen, tragen aber deutlich weniger zum Klimawandel bei. Wohlhabendere Gruppen hingegen verursachen ein Vielfaches an Treibhausgasemissionen. Gesundheitliche Ungleichheiten und klimaschädliches Verhalten verstärken sich also gegenseitig.
Die Referenten stellten dem das Bild einer notwendigen Transformation gegenüber. Gesundheit solle nicht nur als Abwesenheit von Krankheit, sondern als Ressource verstanden werden – mit einem stärkeren Fokus auf Prävention, gerechter Verteilung und ökologischer Nachhaltigkeit. Dazu gehören klimafreundliche Mobilitäts- und Ernährungsangebote, der Abbau gesundheitsschädlicher Subventionen, der Ausbau von Grünräumen und eine aktivere Rolle des Gesundheitssektors in Politik und Gesellschaft. Exemplarisch nannten sie die Reduktion des Fleischkonsums oder städtebauliche Projekte wie die „Superblocks“ in Barcelona, die nachweislich Gesundheit und Lebensqualität fördern.
Im Vergleich zum „Business as usual“ mit hohen Kosten, wachsender sozialer Ungleichheit und ungebremsten Klimafolgen zeichneten Haas und Hutter die Vision eines vorsorgenden, gerechten und resilienten Gesundheitssystems. Eines, das nicht nur Krankheiten behandelt, sondern Gesundheit fördert – und damit gleichzeitig den sozialen Zusammenhalt stärkt und langfristig auch ökonomische Vorteile bringt.
Keynote | Warum machen wir es nicht einfach? Die Psychologie der Klimakrise
Isabella Uhl Hädicke – Umweltpsychologin mit Forschungsschwerpunkt zum Thema Klimawandelkommunikation

In ihrer Keynote beleuchtete die Umweltpsychologin Isabella Uhl-Hädicke die Frage, warum wir trotz des Wissens um die Dramatik der Klimakrise oft nicht ins Handeln kommen. Zwar ist die globale Temperatur seit 1850 bereits um mehr als 1 Grad gestiegen, doch die psychologische Verarbeitung dieser Bedrohung ist komplex. Viele Menschen reagieren auf alarmierende Nachrichten mit einer Schockstarre: Das Gefühl von Ohnmacht führt dazu, dass symbolisch reagiert wird – etwa durch Verdrängung oder Ablenkung – und dass klimaschonendes Verhalten gar nicht erst umgesetzt wird. Entscheidend ist, ob Furcht mit Selbstwirksamkeit einhergeht. Nur wenn Menschen das Gefühl haben, tatsächlich etwas bewirken zu können, wird die Angst in konstruktives Handeln übersetzt. (weiterlesen…)
Uhl-Hädicke warnte daher vor einer Kommunikation, die ausschließlich Bedrohungsszenarien vermittelt. Diese kann Nebenwirkungen wie Rückzug, Abwehrhaltungen oder verstärkten Ethnozentrismus haben. Sinnvoller sei es, Klimathemen an die Lebensrealität der Menschen zu knüpfen, konkrete Handlungsmöglichkeiten („To-dos“) aufzuzeigen und Selbstwirksamkeitserfahrungen zu fördern. Ein weiterer Schlüssel liegt in den sozialen Normen: Menschen orientieren sich stark am Verhalten anderer – manchmal jedoch mit gegenteiligem Effekt.
Besonders eindrücklich illustrierte Uhl-Hädicke diesen Mechanismus anhand von zwei Studien. In einem US-Nationalpark, in dem Besucherinnen und Besucher wiederholt versteinertes Holz entwendeten, wurden unterschiedliche Hinweisschilder getestet. Ohne Schild nahmen rund 3 % der Besucherinnen und Besucher Holzstücke mit, ein klassisches Schild mit der Bitte, nichts mitzunehmen, senkte die Zahl leicht auf 2 %. Ein scheinbar gut gemeinter Hinweis, der auf das weitverbreitete Fehlverhalten anderer aufmerksam machte, hatte dagegen den gegenteiligen Effekt: Die Diebstahlrate stieg auf 8 %. Die Botschaft, dass andere dieses Verhalten zeigten, wirkte also legitimierend.
Ein ähnliches Muster zeigte eine niederländische Feldstudie: Vor einer Wand mit einem klaren Graffiti-Verbotsschild standen Fahrradständer, an denen Werbematerial an die Lenker geklemmt wurde. War die Wand sauber, landeten 39 % der Flyer auf dem Boden. Hatte jedoch jemand trotz Verbot ein Graffiti gesprüht, stieg die Zahl der Wegwerfenden auf 69 %. Das Signal war eindeutig: „Wenn andere sich nicht an die Regeln halten, muss ich es auch nicht.“
Diese Beispiele verdeutlichen, dass der Hinweis auf unerwünschtes Mehrheitsverhalten schnell zum Bumerang-Effekt werden kann. Anstatt Normen zu stärken, schwächen sie das Gefühl, dass Regeln und Nachhaltigkeit von allen getragen werden. Die Referentin plädierte daher für eine vorsichtige und differenzierte Klimakommunikation, die positive Vorbilder sichtbar macht und nachhaltiges Verhalten in den Alltag integriert. Sie verwies auf die Arbeiten von Niki Harré, die empfiehlt, selbst so oft wie möglich sichtbar nachhaltig zu handeln – und gab mit ihrem eigenen Buch „Warum machen wir es nicht einfach?“ eine Lektüreempfehlung, die den psychologischen Mechanismen hinter Klimahandeln (und Nicht-Handeln) nachgeht.
Break-Out-Session | Planetary Health Diet
Mag. Silvia Marchl – Styria vitalis
Christian Hermann | FH JOANNEUM Gesundheits- und Krankenpflege, Österreich

Nach den beiden Keynotes folgte eine erste Break-Out-Session, in der die Teilnehmenden zwischen vier Themenfeldern wählen konnten. Neben Mobilität, Anpassungsmaßnahmen und psychosozialen Aspekten des Klimawandels entschieden sich viele für das Thema „Klimafreundliche Ernährung – Planetary Health Diet“, wo zwei Impulsreferate die Grundlage für Austausch und Diskussion boten. (weiterlesen…)
Silvia Marchl (Styria vitalis) stellte das Projekt „Flora wächst!“ vor, das Großküchen in Schulen, Betrieben und Krankenhäusern bei der Umstellung auf eine stärker pflanzenbasierte Verpflegung unterstützt. Hintergrund ist, dass rund ein Viertel aller Treibhausgase aus der Lebensmittelproduktion stammt. Gleichzeitig fällt es vielen Menschen schwer, sich für gesunde, ausgewogene Mahlzeiten zu entscheiden. Das Projekt läuft bis 2026/27 und bietet vielfältige Maßnahmen: vom „Grünen Teller“ als Auszeichnung für klimafreundliche Speisepläne bis hin zu Workshops für Küchenpersonal, Pädagoginnen und Pädagogen und Kinder. Zentral ist dabei das Konzept des Nudging – kleine, gezielte „Stupser“, die gesündere und nachhaltigere Entscheidungen erleichtern, etwa durch attraktive Speisenbenennungen, bessere Platzierung im Speiseplan oder appetitliche Präsentation. Erste Erfahrungen zeigen, dass Veränderungen vor allem dann funktionieren, wenn sie in mehreren Bereichen gleichzeitig angestoßen werden. Besonders Kinder zeigen dabei eine hohe Offenheit für pflanzenbasierte Angebote.
In der anschließenden Diskussion wurden Foodsharing-Konzepte als möglicher Baustein einer nachhaltigen Gemeinschaftsverpflegung hervorgehoben, da ein hoher Prozentsatz der gesunden Speisen nach wie vor weggeworfen werden muss. Ein Problem bei Foodsharing-Konzepten in diesem Bereich sind allerdings die hygienischen Standards, wenn es um aufgewärmte Speisen geht. Positive Beispiele wie das LKH Villach, wo überschüssiges Essen über einen Verein an Bedürftige verteilt wird, zeigen, dass praktikable Lösungen existieren.
Die Diskussion bot auch gleich die perfekte Überleitung zum zweiten Vortrag, in dem Christian Hermann (FH Joanneum) über Foodsharing als Beitrag zu nachhaltiger Ernährungskompetenz sprach. Er machte deutlich, dass in Europa enorme Mengen an Lebensmitteln verschwendet werden: zwischen 60 und 90 Millionen Tonnen pro Jahr, in Österreich allein rund 40 kg pro Person. Etwa 40 % dieser Abfälle wären vermeidbar. Neben Landwirtschaft, Produktion und Handel sind vor allem private Haushalte Hauptverursacher. Initiativen wie Foodsharing, „Too Good To Go“ oder „Rette mich“-Sackerl leisten hier wichtige Beiträge, indem sie überschüssige Lebensmittel zugänglich machen. Hermann erklärte die Strukturen des Vereins Foodsharing – mit lokalen Botschafterinnen und Botschaftern, Foodsavern und Fairteilern – und betonte, dass das Ziel solcher Initiativen letztlich sei, „sich selbst überflüssig zu machen“, weil weniger Essen verschwendet wird. Dabei spielen auch rechtliche Rahmenbedingungen wie Hygienekontrollen oder die Einhaltung der Kühlkette eine Rolle.
Die Session machte klar: Klimafreundliche Ernährung bedeutet nicht nur mehr pflanzliche Optionen, sondern auch den bewussten Umgang mit Ressourcen, von der Speiseplangestaltung bis zur Vermeidung von Verschwendung.
Posterwalks
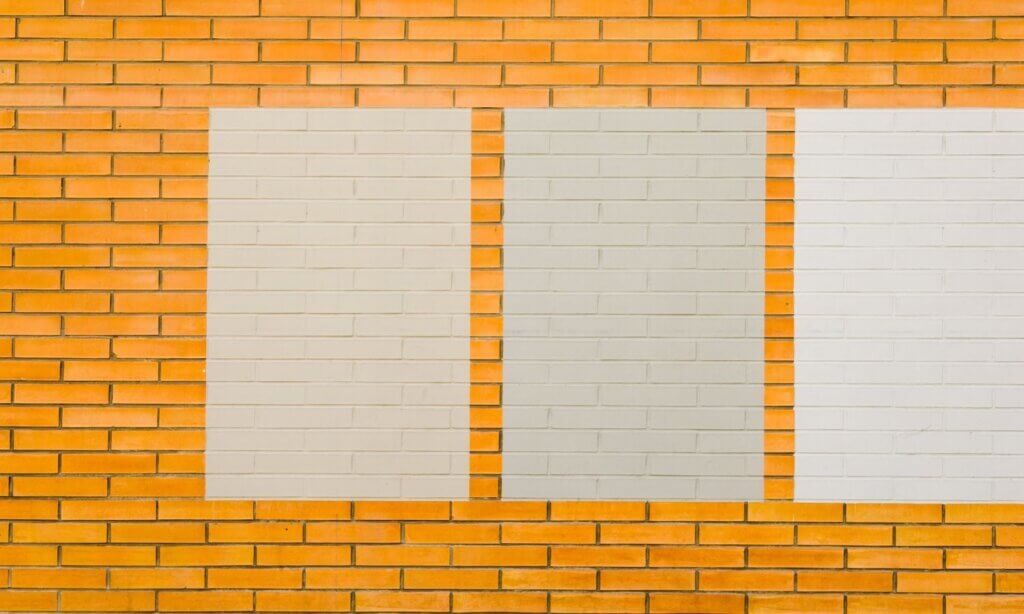
Im Anschluss an die Break-Out-Sessions fanden zwei Posterwalks statt, die den Teilnehmenden die Möglichkeit boten, sich über aktuelle Projekte und Forschungsvorhaben im Bereich klimasensible und gesundheitsbewusste Maßnahmen zu informieren und in den Austausch zu treten. (weiterlesen…)
Die beiden Schwerpunkte waren:
- Klimasensibel und gesundheitsbewusst handeln
- Projekt Corner für Klima- und Nachhaltigkeitsprojekte im Gesundheitsbereich
Die vorgestellten Poster deckten ein breites Spektrum ab – von praxisnahen Maßnahmen im Krankenhausalltag über Bildungsinitiativen bis hin zu Forschungsvorhaben und digitalen Tools:
- Primärversorgung und Resilienz: „Klimaresilienz in der Primärversorgung“ – Ergebnisse einer qualitativen Studie in Österreich (Andrea Stitzel und Johanna Schauer-Berg)
- Digitales Tooling: FMH Toolkit Planetary Health, inkl. eco-doc Treibhausgasbilanzrechner
- Energieeinsparung: „Stromeinsparung im Klinikalltag“ durch PC-Herunterfahren außerhalb der Dienstzeiten (Lena Reiter, Uniklinik Köln)
- Umweltbildung technisches Personal: Fortbildungsreihe für Green Hospitals (ÖVKT, FH Graz, klimaaktiv)
- Netzwerke und Verbände: Vorstellung des ÖVGK – Österreichischer Verband Grüner Krankenhäuser
- Forschung und Beteiligung:
PARADiES – Performative Bürgerbeteiligung und Transformationspfade für Klima, Gesundheit und demografischen Wandel
chAnGE – Climate change and healthy ageing (FH Kärnten und Landeskrankenhaus Villach): Lehreinheiten zu Klimawandel, Risikobewertung, psychischer Resilienz, Katastrophenmanagement, politischer Entscheidungsfindung, digitalen Werkzeugen und Empowerment – Teilnahme erwünscht! - Klimawandel und Öffentlichkeit: Österreichischer HitzeAktionsTag (HAT) – nächster Termin 11. Juni 2026
- Ernährung und Planetary Health Diet: Ergebnisse zu Preisgestaltung, Ernährungsbildung, Gemeinschaftsverpflegung und Werberegulierung (Lane Bawa, Hochschule Burgenland)
- Raumplanung: „Gemeinsam Planen für klimasensiblen und gesundheitsfördernden öffentlichen Raum“ – Leitfaden für Gemeinden und RaumplanerInnen (Styria vitalis)
- Kompetenzentwicklung: „Gesundheitsbezogene Klimakompetenz für Gesundheitsberufe“ – Entwicklung praxisnaher Schulungsinhalte (Hochschule Burgenland, FFG, KABEG, ÖVGK)
- Arbeitsplatz und Nachhaltigkeit: „Gesundheit und Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz gemeinsam gedacht“ – Konzepte und Praxisbeispiele
- Laboralltag: „Laboralltag Grüner und Smarter – BiomedBest“ (Bettina Stelzhammer)
- Psychische Gesundheit: „Mental Health in a Warming World“ – Einfluss regenerativer Stresskompetenz auf das Stresserleben junger Erwachsener bei extremer Hitze (Lea Radlherr, Hochschule Burgenland)
- Klimabilanz von Kliniken: THG-Emissionen von zehn österreichischen Kliniken unter Einschränkung von Scope-3-Emissionen auf Lebensmittel und Energiebezug; Potenzialanalyse zur Einsparung von Fleisch, Milchprodukten etc. nach DGE-Empfehlungen
Die Posterwalks zeigten eindrucksvoll, wie vielfältig das Feld Planetary Health ist und wie viel bereits getan und angestoßen wird – von praktischen Alltagslösungen in Großküchen und Kliniken über digitale Tools und Bildungsangebote bis hin zu politischen und kommunalen Handlungsansätzen. Sie boten nicht nur Einblicke in Best-Practice-Projekte, sondern auch die Gelegenheit zum direkten Austausch, zur Vernetzung und zur Diskussion von Herausforderungen und Lösungsstrategien in der Praxis.
Keynote | Für Pessimismus ist es zu spät!
Helga Kromp-Kolb, BOKU Wien
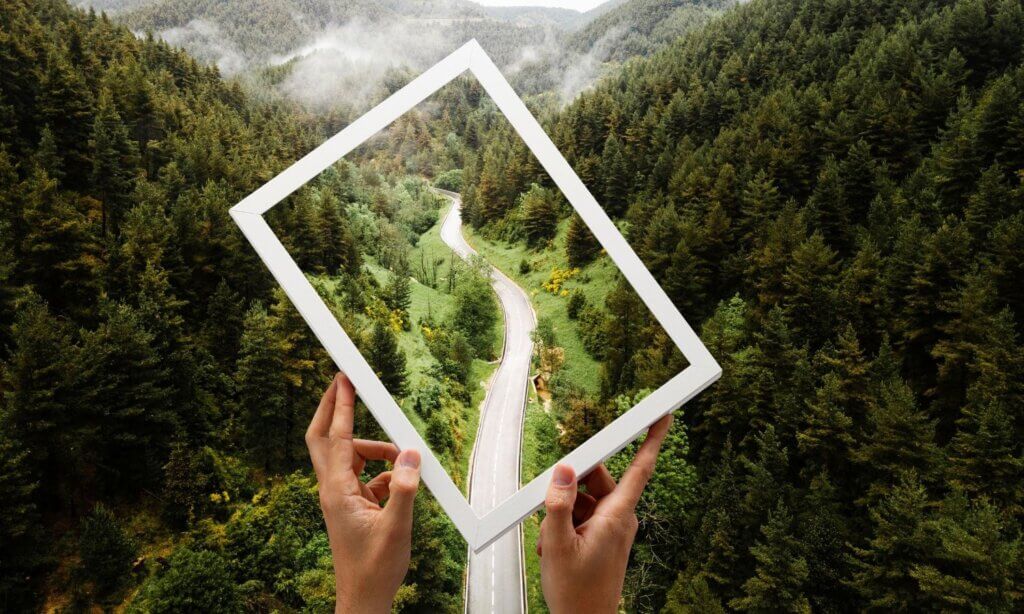
Die renommierte Meteorologin und Nachhaltigkeitsforscherin Helga Kromp-Kolb hielt eine eindringliche Keynote, die zwischen alarmierenden Fakten und einer klaren Vision für notwendige Transformationen oszillierte. Sie zeigte, dass die Realität des Klimawandels die Modelle längst überholt hat: Gletscher schmelzen, Wälder brennen, Landflächen verschwinden – und auch in Österreich sind die Folgen bereits spürbar. Selbstverstärkende Prozesse wie die Eis-Albedo- oder Wasserdampf-Rückkopplung erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Kipp-Punkte überschritten werden. Szenarien wie das Abreißen der Nordatlantikströmung oder ein unbewohnbar heißer Lebensraum in weiten Teilen der Erde sind keine ferne Science-Fiction, sondern reale Risiken. (weiterlesen…)
Doch Kromp-Kolb betonte: „Für Pessimismus ist es zu spät.“ Der Fokus müsse nun auf Transformationsprozessen liegen, die alle Lebensbereiche umfassen. Sie skizzierte eine umfassende Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, die von dezentraler Energieversorgung über Kreislaufwirtschaft und neue Landwirtschaftsmodelle bis hin zu Bildung, Recht, Gesundheit und Demokratie reicht.
Einige Kernelemente ihrer Vision:
- Energie: Dezentral, erneuerbar, lokal – weniger Abhängigkeit von geopolitischen Krisen, bessere Luftqualität, weniger Feinstaubtote.
- Industrie und Konsum: Kreislaufwirtschaft, langlebige und reparierbare Produkte, Teilen statt Besitzen.
- Wirtschaft und Finanzen: Kein Wachstumszwang mehr, Fokus auf Resilienz und Gemeinwohl; Geld als Tauschmittel, nicht als Spekulationsobjekt.
- Recht: Umwelt und Klima als einklagbare Menschenrechte, Natur als Rechtssubjekt.
- Landwirtschaft: Regionale Produktion, artgerechte Tierhaltung, gesunde Böden, Vielfalt statt Monokultur.
- Bildung: Mehr Kreativität, Kooperation und systemisches Denken; Fehler als Lernchance.
- Gesundheitswesen: Fokus auf Prävention, Förderung von Bewegung, Ernährung und psychischem Wohlbefinden; Medizin als Dienstleistung, nicht als Wirtschaftssektor.
- Gesellschaft: Mehr soziale Gerechtigkeit, geringere Einkommensunterschiede, Stärkung der Demokratie durch Partizipation und Begegnungsräume.
- Friedenspolitik: Vertrauensbildung, Friedensbildung gleichwertig neben Militärinvestitionen, internationale Regeln stärken.
Sie plädierte für eine Verschiebung von Lebensstandard zu Lebensqualität – weniger materieller Konsum, mehr Zufriedenheit und Glück, gestützt durch intrinsische Werte wie Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und Solidarität. Am Ende stellte sie drei Leitfragen für die Zukunft:
- Was wollen wir unbedingt beibehalten? (z. B. Menschenrechte, soziale Sicherheit, Zugang zu medizinischer Versorgung)
- Was müssen wir loslassen? (z. B. Wintersport in mittleren Lagen, Billigkonsum, grenzenlose Lebensverlängerung um jeden Preis)
- Was können wir wiederentdecken oder von anderen lernen? (z. B. Eigenverantwortung, Hausmittel, Natur als Rechtssubjekt)
Ihr Fazit: Die Herausforderungen sind weniger eine Frage der Wissenschaft als eine Frage von Weltanschauungen und Werten. Wenn wir eine „Hot House Earth“ vermeiden wollen, müssen wir mutig, unbequem und revolutionär neu denken. Dazu gab es zum Abschluss auch noch zwei im Gedächtnis bleibende Übungen im Arme verschränken und gemeinsam Klatschen, die eindrücklich zeigten: Wer Veränderung möchte, muss die grauen Zellen anstrengen, und was man vorzeigt, wirkt mehr als das, was man sagt.
Vortrag | Klimawandel, gesundheitliche Chancengerechtigkeit und Gesundheitsberufe: Not-wendiges für Gegenwart und Zukunft
Ursula M. Costa, fh gesundheit Tirol

Die Gesundheitswissenschaftlerin Ursula M. Costa stellte in ihrem Vortrag die enge Verknüpfung von Klimawandel, sozialer Ungleichheit und Gesundheit in den Mittelpunkt. Sie machte deutlich, dass Salutogenese – also Maßnahmen, die Gesundheit erhalten und fördern – dringend notwendig ist, um die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu bewältigen. (weiterlesen…)
Ein Schwerpunkt lag auf den vulnerablen Gruppen, die besonders stark betroffen sind. Verwundbarkeit ist dabei nicht statisch, sondern kontextabhängig und veränderbar: Faktoren wie Einkommen, Wohnsituation, Migrationshintergrund, Alter, Geschlecht oder der Wohnort in klimakritischen Regionen können sich überlagern und Risiken verstärken. Wichtig sei, zwischen Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu unterscheiden: Nicht jede Differenz ist per se ungerecht, entscheidend ist der faire Zugang zu Gesundheitsressourcen.
Um in dieser Situation handlungsfähig zu bleiben, präsentierte Costa das Konzept der Resilienzkapazitäten (nach Ziglio et al. 2017):
- Adaptive – anpassungsfähig, um mit Störungen und Druck umzugehen
- Absorptive – absorbierend, um Schocks aufzufangen und sich zu erholen
- Anticipatory – antizipierend, um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu reduzieren
- Transformative – veränderbar, um Strukturen und Systeme zukunftsfähig weiterzuentwickeln
Darüber hinaus sei die Entwicklung von Future(s) Literacy entscheidend – also Zukunftsgestaltungskompetenzen. Dazu zählen das Verständnis für Veränderungen, die Fähigkeit, komplexe Situationen lösungsorientiert zu bewältigen, die Imagination alternativer Zukünfte sowie Akzeptanz im Umgang mit Unsicherheit.
Costa machte deutlich, dass auch Gesundheitsberufe selbst vom Klimawandel betroffen sind: Hitze, Dürre, Wassermangel, Starkregen oder Waldbrände belasten nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern auch Fachkräfte – kognitiv, körperlich, emotional und praktisch. Arbeitsmaterialien, Prozesse, Arbeitswege und Teamstrukturen geraten zunehmend unter Druck. Daher sei es zentral, gesundheitliche Chancengerechtigkeit zu sichern, damit alle gleichermaßen Zugang zu relevanten Ressourcen haben.
Trotz der Schwere des Themas setzte Costa bewusst auch einen hoffnungsvollen Akzent: Durch interdisziplinäre und interprofessionelle Kooperation, durch Netzwerke, Tagungen und alltägliche Transformationen entstehe Handlungsspielraum. „Hoffen heißt, offen sein für Überraschungen“, zitierte sie – und verwies auf die Bedeutung von Kreativität im Umgang mit komplexen Systemen. Leitend sei dabei ein „Leuchtturm“ aus Sinn, Handhabbarkeit und Verstehbarkeit, der Orientierung in unsicheren Zeiten bietet.
Darüber hinaus verwies Costa auf aktuelle wissenschaftliche Arbeiten und Initiativen, die sich mit Klimakompetenzen im Gesundheitswesen befassen. Sie stellte vier Research-Papers sowie eine Initiative vor:
- Research Brief – Gesundheitsbezogene Klimakompetenzen in den Gesundheitsberufen
- Handbuch zur Stärkung der Klimakompetenz in den Gesundheitsberufen
- Research Brief – Klimaresilienz in der Primärversorgung
- Nationale Aktivitäten zur Stärkung der Klimakompetenz in den Gesundheitsberufen in Österreich
- Climate change and healthy AgeinG (chAnGE) – Entwicklung eines E-Learning-Programms für Resilienz und Anpassung, inkl. Dialogformat zur Erstellung berufsgruppenspezifischer Klimakompetenz-Handbücher (GÖG – InnTra). In Verbindung damit erwähnte sie auch eine Studie von Browne und Rutherford mit dem Titel „The Case for “Environment in All Policies“: Lessons from the „Health in All Policies“ Approach in Public Health”
Mit diesem Überblick machte Costa deutlich, dass bereits wichtige Grundlagen für die Stärkung von Klimakompetenz in den Gesundheitsberufen existieren – und dass diese konsequent in Ausbildung, Praxis und Forschung weitergeführt werden müssen.
Vortrag | Gelingende Übergänge: Was ändert sich in und durch Transformationsprozesse?
Marc Richter, Hochschule Burgenland / ZSFB Heidelberg

Der Organisationsberater und Transformationsexperte Marc Richter widmete sich einem Thema, das im Kontext von Wandel und Krisen oft unterschätzt wird: den Übergangsphasen. Veränderungen sind selten linear – „das Alte ist nicht mehr, das Neue ist noch nicht“. Genau in diesem Dazwischen entstehen Unsicherheit, Spannungen und Ambivalenzen, die Menschen wie Organisationen herausfordern. Richter nutzte Caspar David Friedrichs Gemälde „Mönch am Meer“ als Bild für diese Zwischenräume, in denen Vertrautes verloren geht, Neues aber noch nicht greifbar ist. (weiterlesen…)
Er zeigte, dass Übergänge von inneren und organisationalen Konflikten geprägt sind: Verunsicherung, Angst, Paradoxien, Zweifel, Widersprüche, Krisen oder das Gefühl von Chaos. Solche Phänomene werden oft als Störung oder Defizit betrachtet – doch Richter plädierte dafür, sie als natürliche Begleiter von Wandel zu sehen. „Was, wenn die Krisenphänomene des Dazwischen nicht das Problem sind, sondern die Lösung?“ Spannungen, so seine These, sind Ausdruck von Lebendigkeit (Bios) und können, wenn sie bewusst reflektiert und gestaltet werden, zu produktiven Ressourcen für Entwicklung werden.
Für gelingende Übergänge brauche es:
- Rituale des Abschieds (Trennung vom Alten)
- Rituale der Wiedereingliederung (Integration des Neuen)
- Reflexionserfahrungen im „Dazwischen“ – individuell, in Gruppen und in Organisationen
- Ein Umdenken: Ambivalenzen und Paradoxien nicht bekämpfen, sondern als kreative Ressourcen begreifen
Richters Thesen zum Wandel lassen sich so zusammenfassen:
- Romantische Vorstellungen von Veränderung sind trügerisch.
- Jede Veränderung verändert auch den Weg, nicht nur das Ziel.
- Übergänge folgen einer anderen Logik als stabile Zustände.
- Das, was als Chaos, Zweifel oder Krise erscheint, ist Teil des Prozesses – und kann durch Reflexion zu einem Vor-Bild für Entwicklung werden.
Als Anregungen verwies Richter auf Hans Rudi Fischers Buch „Ins Dazwischen – Expedition in das Krisengebiet der Vernunft“ sowie die Paul Watzlawick Tage im Oktober 2025 in Villach, wo diese Fragen vertieft diskutiert werden.
Break-Out-Sessions

Am Nachmittag stand eine weitere Break-Out-Session im Zeichen der Ausbildung: Unter dem Titel „Klimakompetenz in den Gesundheitsberufen“ wurden vier parallele Themenstränge angeboten – Pflege, Hebammen, Sozialberufe und die MTD-Berufe (medizinisch-technische Dienste). Letztere Session beleuchtete, wie sich Klimakompetenz in die Curricula von Diätologie, Ergotherapie und Co. integrieren lässt, und zeigte anhand von drei Kurzvorträgen konkrete Ansätze und Erfahrungen aus der Praxis. (weiterlesen…)
Kurzvortrag | Diätologie und Ergotherapie im Klimadialog
Sabine Dielacher und Klaus Nigl, FH Gesundheitsberufe OÖ, Linz
In den Studiengängen Diätologie und Ergotherapie wurde ein innovatives Lehrformat entwickelt, das Gesundheits- und Klimakompetenz miteinander verknüpft. In der Lehrveranstaltung RLL4U erarbeiten Studierende konkrete Gesundheitsförderungsangebote – von klimafreundlichem Essen im Studienalltag bis hin zu Themen wie Resilienz, Achtsamkeit oder Prokrastination. Dabei sind Eigeninitiative und Kreativität ausdrücklich gefragt. Die Ergebnisse stärken nicht nur das Bewusstsein der Studierenden für gesundheits- und klimaförderliches Verhalten, sondern entfalten auch Öffentlichkeitswirksamkeit über die Hochschule hinaus. Zudem werden Erfahrungen gesammelt, wie Lifestyle-Empfehlungen praktisch umsetzbar sind – ein wichtiger Kompetenzgewinn für die spätere Berufspraxis in Diätologie und Ergotherapie.
Kurzvortrag | Ergebnisse der Studierendenbefragung zur Gestaltung der Lehre von Klimakompetenzen am STG Physiotherapie
Elena Fluch und Uschi Halbreiner, FH Kärnten
Seit Inkrafttreten des MTD-Gesetzes 2024 gehören Klimakompetenzen zu den allgemeinen Anforderungen für Gesundheitsberufe. Am Studiengang Physiotherapie der FH Kärnten werden entsprechende Inhalte bereits seit 2022 in die Lehre integriert. Um diese stärker an den Interessen der Studierenden auszurichten, wurde 2024 die Befragung „KlimaGesund“ unter Erstsemestrigen durchgeführt.
Die Ergebnisse zeigen: Besonders relevant erscheinen den Studierenden die Themen Ernährung und grüne Gesundheitseinrichtungen, gefolgt von Wald und CO₂-Fußabdruck. Im späteren Berufsfeld möchten sie vor allem auf nachhaltige Materialien setzen und durch Bewusstseinsbildung wirken. Für die Lehre wünschen sie sich vor allem Diskussionen, Vorträge und Gruppenarbeiten in Präsenz. Eine klare Mehrheit sprach sich dafür aus, Klimakompetenz in bestehende Lehrveranstaltungen zu integrieren, statt eigene Module zu schaffen.
Damit liefert die Befragung wichtige Hinweise, wie Klimakompetenz in der Ausbildung praxisnah und studierendenorientiert vermittelt werden kann.
Kurzvortrag | XR als Tool für Klimakompetenz: Brückenschlag zwischen Gesundheit, Technologie und Nachhaltigkeit in der Ergotherapie
Barbara Prinz-Buchberger, Christine Spevak-Grossi, Rita Weber-Stallecker (IMC Krems) und Katharina Benedetter (Future Minds)
Im Forschungsprojekt „GreenTouch“ wird untersucht, wie Extended Reality (XR) zur Vermittlung von Klimakompetenzen in der Ergotherapie beitragen kann. Ziel ist es, immersive Szenarien zu entwickeln, die die enge Verbindung zwischen planetarer und menschlicher Gesundheit erfahrbar machen. Erste Ergebnisse zeigen, dass XR-Technologien komplexe Zusammenhänge anschaulich darstellen und durch die Kombination von emotionalem Erleben und kognitivem Lernen die Bereitschaft zu klima- und gesundheitsfreundlichem Handeln deutlich erhöhen.
In co-kreativen Workshops wurden bereits erste Szenarien entworfen – etwa zur Bewältigung von Hitzebelastung oder Extremwetterereignissen. Diese verbinden persönliche Betroffenheit mit praktischen Lösungsansätzen und fördern so Selbstwirksamkeit. Das Projekt versteht sich als innovatives Bildungswerkzeug, das nicht nur Ergotherapeutinnen und -therapeuten unterstützt, sondern auch als Modell für das Gesundheitswesen insgesamt dienen kann.
Abschluss des ersten Konferenztags
Den Konferenztag begleitete der Künstler Reinhard Gussmagg, der die vielfältigen Inhalte in Echtzeit grafisch verdichtete und am Abend als eindrucksvolles Big Picture präsentierte. So wurde der Tag auch visuell zu einer Reise durch die Themen von Klimawandel, Gesundheit und Transformation. Den feierlichen Ausklang bildete ein Galadinner im Kulturzentrum Oberschützen: Regionale und saisonale Spezialitäten, begleitet von einer Weinverkostung, sorgten für genussvolle Momente – und blieben zugleich dem nachhaltigen Leitgedanken der Konferenz treu.
Start des Konferenztags Nr. 2
Nach einem intensiven ersten Konferenztag, der vor allem die großen Zusammenhänge von Klimakrise, Gesundheit und gesellschaftlicher Transformation beleuchtete, rückte am zweiten Tag die praktische Umsetzung stärker in den Vordergrund. Den Auftakt machte eine Keynote von Andrea Schmidt (Gesundheit Österreich GmbH) zu Klimaresilienz im Gesundheitssystem, bevor Erwin Gollner die Planetary Health Charta 2030 präsentierte – ein strategisches Rahmenwerk, das Organisationen, Hochschulen und Berufsverbände in die Verantwortung nimmt, Klimakompetenz und Nachhaltigkeit fest im Gesundheitswesen zu verankern.
Vorstellung der Planetary Health Charta 2030
Erwin Gollner, Hochschule Burgenland

Ein Höhepunkt des zweiten Konferenztages war die Präsentation der Planetary Health Charta 2030 durch Erwin Gollner. Die Charta wurde in einem partizipativen Prozess entwickelt und soll als strategischer Handlungsrahmen für Organisationen, Hochschulen, Berufsverbände und Praxiseinrichtungen dienen. Ihr Kern: Die weitreichenden gesundheitlichen Folgen des Klimawandels anzuerkennen – und die Verantwortung, das Gesundheitswesen aktiv und nachhaltig zu transformieren. (weiterlesen…)
Bereits 30 Organisationen haben die Charta unterzeichnet, darunter die Hochschule Burgenland, die FH Kärnten, die FH Campus Wien, die FH Vorarlberg sowie die Berufsverbände Ergotherapie Austria, Physio Austria, Diätologie Austria und Logopädie Austria. Weitere Unterzeichnende sind ausdrücklich willkommen.
Die Charta ruht auf vier zentralen Säulen:
- Gesundheitsbezogene Klimakompetenz entwickeln
– Verankerung in Aus- und Weiterbildung, systematische Kompetenzentwicklung für Lehrende, praxisnahe Förderung bei Auszubildenden und Fachkräften, Definition als Standard in Berufsbildern. - Intra- und interprofessionelle Zusammenarbeit stärken
– Aufbau eines berufsgruppenübergreifenden Arbeitskreises, Entwicklung von Qualitätsstandards und Leitlinien, sowie Förderung einer aktiven Netzwerkkultur zwischen Hochschulen, Praxiseinrichtungen und Verbänden. - Klimagerechte Lebens-, Arbeits- und Lernwelten schaffen
– Gestaltung von Infrastruktur und Materialien im Sinne von Klimaschutz und Klimaanpassung, Reflexion des eigenen Handelns und Förderung nachhaltiger Arbeitsweisen. - Zusammenarbeit über das Gesundheitswesen hinaus fördern
– Sektorenübergreifender Austausch, gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte, sowie die klare Positionierung von Gesundheitsthemen in politischen Diskursen zum Klimawandel.
Ein symbolisches Detail unterstrich die Vision: Die Charta wurde auf Samenpapier gedruckt – wer möchte, kann das Dokument einpflanzen und so buchstäblich „zum Aufblühen bringen“. Ein starkes Bild für das, was die Charta bewirken will: Wachstum, Vernetzung und konkrete Transformation.
Impulsvortrag | Durch Veränderung führen
Marc Richter, Hochschule Burgenland / ZSFB Heidelberg

Nach seinem Beitrag am ersten Konferenztag kehrte Marc Richter zurück, um die Frage zu beleuchten, wie Führung in Zeiten des Wandels gelingen kann. Seine Kernbotschaft: Veränderung entsteht nicht durch Fakten, sondern durch Kommunikation. Zwar wollen viele Menschen „Veränderung“, doch nur wenige sind bereit, selbst zu verändern oder gar den Prozess aktiv zu führen. (weiterlesen…)
Richter stellte klar: Klassische Hierarchien und Organigramme stoßen in Veränderungskontexten schnell an ihre Grenzen. Führung dürfe nicht mit reiner Steuerung verwechselt werden, sondern sei vor allem ein Angebot zur gemeinsamen Orientierung im „Dazwischen“ – vergleichbar mit einem Tanz, bei dem Selbstführung die Voraussetzung ist, um andere führen zu können. Wer sich selbst reflektiert und verändert, wird so zum Vor-Bild für andere.
Ein zentrales Konzept seines Vortrags war die Ambivalenz. Sie sei kein Hindernis, sondern eine Quelle von Energie, Identität und Entwicklungskraft. Ambivalenz bedeute, Gegensätze auszuhalten, zeitliche Übergänge zu erfahren und diese Spannungen produktiv zu nutzen. Richter skizzierte vier Schritte, um mit Ambivalenz konstruktiv umzugehen:
- Erkennen der Ambivalenz in sich und anderen.
- Zur Sprache bringen – Kommunikation und Selbstdiagnostik.
- Verstehen und reframen – der Ambivalenz Sinn zuschreiben.
- Transformieren – Konsequenzen ins reale Leben übertragen.
Sein Fazit: Führung ist immer auch Selbstführung. Sie verlangt Reflexion, Leidenschaft und die Fähigkeit, Ambivalenz nicht zu vermeiden, sondern als Triebkraft für gelingende Übergänge zu nutzen.
Break-Out-Sessions

Die Break-Out-Session „Klimaresilienz in den Gesundheitsberufen & Next Steps für Berufsverbände“ war eine von vier parallelen Sessions am zweiten Konferenztag, die jeweils unterschiedliche Handlungsfelder der Klimaresilienz beleuchteten – von Bildungsorganisationen über Gesundheitsinstitutionen bis hin zur Policy-Ebene. In dieser Session, geleitet von Mag.a Gabriele Jaksch (MTD Austria, Dachverband der geh. medizinisch-therapeutischen diagnostischen Gesundheitsberufe Österreich) und Sabine Weissensteiner (rtaustria, Berufsfachverband für Radiologietechnologie), stand die Perspektive der einzelnen Berufsgruppen im Mittelpunkt. (weiterlesen…)
Sie eröffnete eine intensive Ideensammlung mit den Teilnehmenden. Ausgangspunkt war die Frage: Was verbinde ich spontan mit Klimaresilienz in meinem Beruf? Dabei kristallisierten sich vier zentrale Perspektiven heraus: strukturell/organisatorisch, Belastung für Fachkräfte, Auswirkungen auf PatientInnen/KlientInnen und die Rolle der Berufsverbände.
Auf struktureller Ebene standen nachhaltige Praxisprozesse im Vordergrund: Abfall reduzieren, recyceln und wiederverwerten, ein nachhaltiges Untersuchungsmanagement etablieren und langfristige Planungsstrategien entwickeln. Gleichzeitig wurde die Belastung für Fachkräfte betont: psychische Beanspruchung durch Hitze, die Notwendigkeit, Wissen kontinuierlich zu erwerben, Arbeitszeiten neu zu denken und Rahmenbedingungen anzupassen, um Resilienz zu fördern.
Bezüglich der PatientInnen und KlientInnen zeigten sich konkrete Klimaauswirkungen: Hitze, Bewegungsmangel und Ernährungsfragen. Hier wurde diskutiert, wie Bewegung und Ernährung als „Medikament“ wirken können, aber auch die Bedeutung von Mobilität und Ressourcenmanagement hervorgehoben.
Die Berufsverbände wurden als zentrale Akteure für transformative Prozesse identifiziert. Sie sollen Bewusstsein schaffen, Positionspapiere und Leitlinien entwickeln, die Vernetzung mit der Ausbildung sicherstellen, Aus- und Weiterbildung fördern sowie politisch lobbyieren. Besonders hervorgehoben wurde die neue gesetzliche Pflicht für MTD-Berufe (gemäß MTD-Gesetz 2024), Klimakompetenz zu erwerben. Durch die enge Zusammenarbeit mit PatientInnen können diese Berufsgruppen eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung klimabezogener Veränderungen einnehmen.
Grundlagenwissen aus den Fachbereichen wurde diskutiert: Physiotherapie verbindet Bewegung und Körper mit Klimaaspekten, Ergotherapie setzt auf gesunde Betätigung im Kontext der Umwelt, Diätologie verknüpft „One Health“-Prinzipien zwischen Ernährung und Umwelt, Logopädie berücksichtigt Umwelteinflüsse auf Stimme und Atmung. Reflexionsfähigkeit, Flexibilität und Kreativität gelten als zentrale Kompetenzen für die tägliche Praxis, ergänzt durch konkrete Maßnahmen wie Hitzepläne, Flüssigkeitsmanagement oder klimafreundliche Praxisorganisation. Auch Nachhaltigkeitsbewusstsein, Datenkompetenz und interdisziplinäre Kommunikation wurden betont. Beispiele von Best-Practice-Initiativen der Berufsverbände rundeten die Session ab.
Abschließend wurden konkrete To-dos für Berufsverbände entwickelt:
- Fort- und Weiterbildung: SDG-Standards implementieren, Wissen in Kompetenz übersetzen, psychische Klimakompetenz fördern und fachliche Netzwerke wirtschaftlich nutzen.
- Leitlinien und Standards: Behandlungsmanagement und Checklisten entwickeln (z. B. „Smarter Medicine – Top 5 Use wisely“).
- Austausch und Vernetzung: Netzwerke zwischen Gesundheitsberufen stärken, Kompetenzlandkarten erstellen und Erfahrungen systematisch teilen.
Das Fazit der Session: Klimaresilienz in den Gesundheitsberufen ist multidimensional und erfordert ein Zusammenspiel von organisationalen Maßnahmen, fachlicher Expertise, persönlicher Reflexion und der aktiven Rolle von Berufsverbänden als Treiber für nachhaltige Transformation.
Umweltmigration – oder die Vertreibung aus dem Paradies?
Piero Lercher, Medizinische Universität Wien Umweltmediziner und Umweltreferent der Österreichischen Ärztekammer

Im Vortrag „Umweltmigration – oder die Vertreibung aus dem Paradies?“ beleuchtete Piero Lercher die komplexen Zusammenhänge zwischen Klimawandel, Umweltveränderungen und menschlicher Migration. Er machte deutlich, dass Migration nicht monokausal zu verstehen ist: Persönliche oder religiöse Verfolgung, Dauerarbeitslosigkeit und die Hoffnung auf einen besseren Lebensstandard spielen ebenso eine Rolle wie Umweltveränderungen. Eine zentrale rechtliche Klarstellung: Im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention gibt es bislang keine explizite Kategorie für Klima- oder Umweltflüchtlinge. Auch die Definition der Internationalen Organisation für Migration (IOM) berücksichtigt Klimamigration nicht direkt, sondern konzentriert sich auf Migration im Kontext von Umweltveränderungen. (weiterlesen…)
Lercher unterschied drei Typen der Umweltmigration: Menschen, die freiwillig ihre Heimat aufgrund von Umweltveränderungen verlassen (Umweltmigranten); Personen, die gezwungen sind, um Leib und Leben zu schützen (umweltbedingte Dislozierung); und solche, die infolge geplanter Landschaftsveränderungen umgesiedelt werden (entwicklungsbedingte Dislozierung). Auf europäischer Ebene wird Klimamigration bisher nur am Rande betrachtet, vor allem unter Sicherheitsaspekten. Nur Finnland und Schweden haben Umweltmigration in nationale Rechtsregelungen aufgenommen, während die EU keine einheitliche Definition vorsieht. Ein Lichtblick war die Resolution der Vereinten Nationen vom Juli 2022, die das Recht auf ein Leben in einer sauberen und gesunden Umwelt weltweit erstmals anerkennt.
Die Zunahme umweltmotivierter Migration ist unübersehbar: Naturkatastrophen lösen mehr als dreimal so viele Vertreibungen aus wie Konflikte oder Gewalt. In den letzten zehn Jahren wurden etwa 220 Millionen Menschen innerhalb ihrer Länder durch klimabedingte Katastrophen vertrieben. Allein 2024 verließen rund 45,8 Millionen Menschen ihre Heimat aufgrund von Katastrophen. Die Anzahl extremer Naturereignisse steigt: 2024 wurden weltweit 393 Katastrophen gezählt, mit über 16.700 Todesopfern, 167 Millionen Betroffenen und wirtschaftlichen Schäden von rund 242 Milliarden US-Dollar. Lercher nannte auch erste Fälle von Anerkennung: 2014 gewährte Neuseeland einer Familie aus Tuvalu als weltweit erste den Status von Klimaflüchtlingen.
Trotz dieser Entwicklungen sind Zahlen, Daten und Prognosen zur Klimamigration häufig noch ungenau. Lercher betonte die Notwendigkeit integrierter Modellanalysen, die sozioökonomische und klimatische Faktoren verknüpfen, um realistische Szenarien zu entwickeln. Prognosen zufolge könnten bis 2050 zwischen 25 Millionen und 1 Milliarde Menschen weltweit von umweltbedingter Migration betroffen sein.
Als Lösungsansätze präsentierte Lercher Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen: Frühwarnsysteme für Katastrophen, Erkennungssysteme für größere Migrationsbewegungen, verbesserte Industriestandards, nachhaltigere Anbaumethoden zur Minimierung ökologischer Schäden sowie parallele Wiederaufbauprojekte nach Katastrophen. Sein Fazit: Umweltmigration ist ein zunehmend dringliches globales Thema, das sowohl präventive Strategien als auch rechtliche und politische Anpassungen erfordert, um die menschlichen, ökologischen und ökonomischen Folgen abzufedern.
Podiumsdiskussion

Anschließend an die Vorträge fand eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern aus Berufsverbänden, Ausbildungsinstitutionen, Hochschulen, Forschung und Gesundheitspolitik statt. Auf dem Podium waren Mag.a Gabriele Jaksch (MTD Austria), Elisabeth Potzmann (Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband, ÖGKV), Beate Kayer (Hochschule Burgenland und Österreichisches Hebammengremium, ÖGH), Piero Lercher (Medizinische Universität Wien), Ursula M. Costa (fh gesundheit Tirol) und Andrea Schmidt (Gesundheit Österreich GmbH). Die Runde diente dem Austausch über Kompetenzen, Best-Practice-Beispiele und gewünschte Veränderungen. (weiterlesen…)
Kompetenzen im Gesundheitsbereich:
Die Diskussion machte deutlich, dass Klimakompetenz zunehmend zentral für alle Gesundheitsberufe wird. Jaksch betonte die gesetzliche Verankerung der Klimakompetenz im neuen MTD-Gesetz 2024 und die besondere Verantwortung der MTD-Berufe durch ihre Nähe zu Patientinnen und Patienten. Potzmann wies auf die hohe Arbeitsbelastung der Pflege hin, zugleich aber auf deren Offenheit für neue Themen und Verantwortung. Kayer berichtete von praktischen Herausforderungen wie extremen Temperaturen in Wohnräumen oder Krankenhäusern, die den Arbeitsalltag und die Betreuung von Schwangeren und Familien erschweren. Lercher ergänzte die medizinischen Dimensionen, z. B. Zunahme von Unfällen, Infektionskrankheiten und psychischen Erkrankungen, sowie sportmedizinische Aspekte wie Hitzeadaptation und Ernährungs- und Bewegungskompetenz. Costa hob die Rolle der Hochschulen hervor, geschlossene Labore und interdisziplinäre Brücken zu nutzen, während Schmidt Awareness, Action und Advocacy als zentrale Instrumente nannte und die Aufwertung von Care-Arbeit thematisierte.
Best-Practice-Beispiele:
Jaksch verwies auf Auszeichnungen für klimafreundliche Praxen, internationale Prinzipien in der Ergotherapie, themenspezifische Newsletter in der Physiotherapie und Seminarangebote in der Diätologie. Potzmann erwähnte internationale Pflegepapiere und Studien, Kayer die Digitalisierung der Hebammenzeitung, Nachhaltigkeitsbeauftragte in Verbänden und Initiativen wie „Midwifes for Future“. Lercher verwies auf Lehrgänge in Public Health und Umweltmedizin, Costa auf die Begleitung von Abschlussarbeiten und Leitfäden, Schmidt auf Trainingsprogramme und gesetzliche Verpflichtungen in anderen Ländern wie UK oder Finanzierungstöpfe in Finnland.
Gewünschte Änderungen im Blick auf die Charta 2030:
Die Teilnehmenden betonten die Notwendigkeit, Klima- und Nachhaltigkeitsthemen stärker in der Praxis zu verankern. Jaksch berichtete über die Integration des Themas in das MTD-Forum 2025. Potzmann hob die Aufnahme in die Gesundheitsberufe-Konferenz hervor und betonte die Relevanz praxisnaher Maßnahmen wie Disaster Nurse Programme und Pflege-Register. Kayer forderte mehr Vernetzung zwischen Berufsverbänden und die Beachtung von Frauen- und Reproduktionsrechten in Katastrophensituationen. Lercher wünschte das Ärztekammer-Logo auf der Charta 2030 und die Implementierung von Klima-Feedbacksystemen in Krankenhäusern und Ordinationen. Costa betonte Partnerschaftlichkeit zwischen Hochschulen, Praxis und allen Sektoren, Schmidt die strategische Verankerung in Curricula und Legislatur, um nachhaltige Veränderungen zu sichern.
Die Diskussion unterstrich, dass Klimakompetenz eine interdisziplinäre Aufgabe ist, die Ausbildung, Praxis, Berufsverbände und politische Rahmenbedingungen miteinander verzahnt. Gleichzeitig wurde deutlich, dass strukturelle Maßnahmen, praxisnahe Lösungen und langfristige Strategien erforderlich sind, um Klimawandel und Umweltveränderungen effektiv in den Gesundheitsalltag zu integrieren.
Health Research Award
Vor dem Abschluss des Konferenztages wurde der Health Research Award verliehen, eine Auszeichnung für herausragende Abschlussarbeiten im Bereich Gesundheitsmanagement. Die Prämierung erfolgte in zwei Kategorien: Klima und Gesundheit sowie Gesundheitsversorgung.
Bereich Klima und Gesundheit:
- 3. Platz: Miriam Dufek (Hochschule Burgenland) für ihre Arbeit „Green Hospital – ökologische Nachhaltigkeit am Beispiel des Landeskrankenhauses Villach“.
- 2. Platz: Nina Wallner (Hochschule Burgenland) untersuchte „Klimawandel und Gesundheit am Arbeitsplatz. Potenziale und Herausforderungen für ein klimasensibles Betriebliches Gesundheitsmanagement im Kontext der planetaren Gesundheit“.
- 1. Platz: Elisabeth Zöchling (Hochschule Burgenland) erhielt die Auszeichnung für „Co-Benefits für Klima und Gesundheit am Beispiel aktiver Mobilität im ländlichen Raum“.
Bereich Gesundheitsversorgung:
- 3. Platz: Magdalena Wutzl im Bereich Orthoptistik (Titel der Arbeit nicht verfügbar).
- 2. Platz: Maria Tholhuijsen für „What are the attitudes of Flemish healthcare professionals and experts towards end-of-life decisions in minors?“.
- 1. Platz: Anna-Maria Kölbl wurde für ihre Arbeit „Neue Wege in der österreichischen Gesundheitsversorgung durch Nurse Entrepreneurship“ ausgezeichnet.
Die Preisverleihung unterstrich die Vielfalt und Relevanz der Forschungsarbeiten – von praktischen Ansätzen zu ökologischer Nachhaltigkeit über betriebliche Gesundheitsstrategien bis hin zu innovativen Modellen in der Gesundheitsversorgung – und zeigte den Beitrag junger Fachkräfte zur Weiterentwicklung der Gesundheitsbranche auf.
Den Abschluss des Konferenztages gestaltete wieder Reinhard Gussmagg mit dem Big Picture des Tages, das die zentralen Inhalte, Themen und Diskussionen des Tages zusammenfasste. Anschließend sprach Erwin Gollner ein Dankeswort an alle Teilnehmenden und kündigte die nächste Planetary Health Konferenz für 2027 an:
Diese wird in Dornbirn stattfinden und von den OrganisatorInnen Marlene Brettenhofer (aks gesundheit) und Guido Kempter (FH Vorarlberg) ausgerichtet.
Die Teilnehmenden dürfen sich auf die Nachbereitung freuen: Das gesammelte Big Picture der Konferenz sowie der Abstract-Band werden voraussichtlich im Oktober zugestellt. Der Abschluss rundete den Tag ab und bot eine klare Perspektive auf die Fortsetzung des Dialogs zu Planetary Health in Österreich.
Header © KI | Freepik




