Krebs betrifft Körper, Seele und Alltag. Neben der medizinischen Behandlung ist in der Onkologie die therapeutische Begleitung durch Physiotherapie, Ergotherapie, Psychoonkologie, Diätologie, Logopädie und kreative Therapien ein zentraler Baustein für Lebensqualität und Rehabilitation.
Eine Krebsdiagnose verändert das Leben grundlegend. Neben der onkologischen Akuttherapie – Operation, Chemotherapie, Strahlentherapie oder Immuntherapie – brauchen Patientinnen und Patienten Unterstützung, um mit körperlichen, psychischen und sozialen Folgen umzugehen. Hier kommen verschiedene therapeutische Fachrichtungen ins Spiel, die den Genesungsprozess begleiten und die Lebensqualität verbessern.
Inhaltsverzeichnis
- Physiotherapie: Ganzheitliche Begleitung während und nach der Krebstherapie
- Ergotherapie: Selbstständigkeit und Lebensqualität während und nach der Krebstherapie
- Psychoonkologie: Seelische Stärke in einer herausfordernden Zeit
- Ernährung und Diätologie: Mit Kraft durch die Therapie
- Logopädie: Sprache und Schlucken zurückgewinnen
- Kunsttherapie: Ausdruck finden, innere Stärke gewinnen
- Gemeinsam stark: Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Onkologie
Physiotherapie: Ganzheitliche Begleitung während und nach der Krebstherapie

Krebs verändert nicht nur das Leben psychisch, sondern fordert den Körper stark. Physiotherapie hilft Patientinnen und Patienten, die körperlichen Folgen der Erkrankung und der Behandlung zu bewältigen.
Bewegung, Kraft und Mobilität
Während der Therapie unterstützen Physiotherapeutinnen und -therapeuten durch gezielte Übungen, Schmerzen zu lindern, Gelenkfunktionen zu erhalten und Muskelschwund vorzubeugen. Nach abgeschlossener Behandlung liegt der Fokus auf der Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit: Kraft, Ausdauer und Koordination werden aufgebaut, Mobilität und Gleichgewicht gefördert, und Patientinnen und Patienten lernen, ihren Alltag wieder selbstständig zu meistern. Studien zeigen, dass individuell angepasste Trainingsprogramme nicht nur die körperliche Funktionsfähigkeit verbessern, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden steigern.
Fatigue – ein zentrales Anwendungsfeld
Ein besonders häufiges Problem ist die tumorassoziierte Fatigue (CRF): eine tiefe, anhaltende Erschöpfung, die selbst nach ausreichendem Schlaf bestehen bleibt und Alltag und Beruf stark einschränkt. Hier zeigt Physiotherapie ihre Wirkung besonders deutlich. Aktuelle Metaanalysen belegen, dass gezieltes Ausdauer- und Krafttraining die Fatigue signifikant reduziert und gleichzeitig die Lebensqualität verbessert (Journal of Oncology Practice, 2024).
Durch den Einsatz von Bewegung als therapeutischem Werkzeug können Patientinnen und Patienten nicht nur gegen die Erschöpfung ankämpfen, sondern auch ihre körperliche Resilienz stärken. Expertinnen und Experten empfehlen daher, Physiotherapie frühzeitig in die onkologische Versorgung zu integrieren – sowohl während der aktiven Behandlung als auch in der Nachsorge (PubMed, 2023).
Ergotherapie: Selbstständigkeit und Lebensqualität während und nach der Krebstherapie
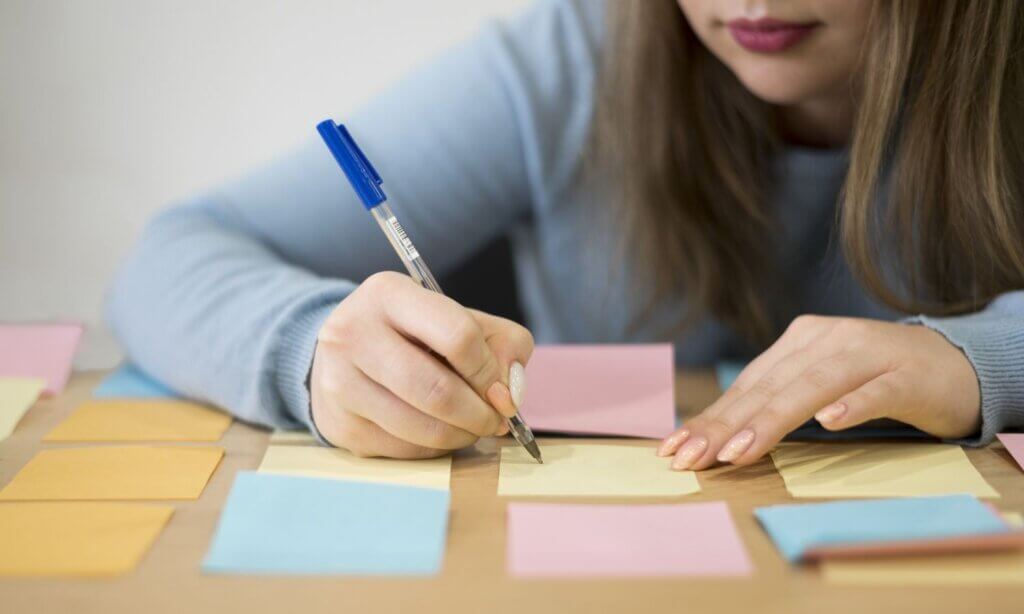
Krebs verändert nicht nur den Körper, sondern fordert auch die geistigen und praktischen Fähigkeiten heraus. Ergotherapie unterstützt Patientinnen und Patienten dabei, ihre Selbstständigkeit zu bewahren oder zurückzugewinnen und den Alltag trotz Einschränkungen zu meistern.
Alltagsbewältigung und Selbstständigkeit
Während der Krebstherapie können Einschränkungen in der Beweglichkeit, Kraft oder kognitiven Funktionen auftreten, die die Durchführung alltäglicher Aktivitäten erschweren. Ergotherapeutinnen und -therapeuten arbeiten mit Patientinnen und Patienten daran, Strategien zu entwickeln, um diese Aktivitäten trotz Einschränkungen zu bewältigen. Dies kann durch die Anpassung von Tätigkeiten, den Einsatz von Hilfsmitteln oder die Umgestaltung des häuslichen Umfelds erfolgen. Ziel ist es, die Selbstständigkeit der Patientinnen und Patienten zu erhalten oder wiederherzustellen.
Kognitive Unterstützung und psychosoziale Begleitung
Krebstherapien können auch kognitive Beeinträchtigungen wie Konzentrationsstörungen oder Gedächtnisprobleme verursachen. Ergotherapeutinnen und -therapeuten setzen gezielte Übungen ein, um diese Funktionen zu trainieren und die geistige Leistungsfähigkeit zu fördern. Darüber hinaus bieten sie psychosoziale Unterstützung an, um mit den emotionalen Belastungen der Erkrankung umzugehen und die Lebensqualität zu steigern.
Neue Erkenntnisse in der Ergotherapie bei Krebs
Aktuelle Studien belegen die Wirksamkeit ergotherapeutischer Interventionen in der onkologischen Versorgung. Eine Untersuchung zeigte, dass Patientinnen und Patienten, die während ihres stationären Aufenthalts Ergotherapie erhalten, eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Entlassung erneut stationär aufgenommen zu werden. Dies unterstreicht die Bedeutung der Ergotherapie in der präventiven Versorgung und der Förderung der Selbstständigkeit der Patientinnen und Patienten (Journal of Cancer Survivorship, 2024).
Psychoonkologie: Seelische Stärke in einer herausfordernden Zeit

Eine Krebsdiagnose verändert das Leben von Grund auf. Neben den körperlichen Belastungen durch Operation, Chemo- oder Strahlentherapie stellt vor allem die seelische Verarbeitung eine große Herausforderung dar. Die Psychoonkologie unterstützt Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen dabei, mit Ängsten, Unsicherheiten und Veränderungen umzugehen – und trägt damit wesentlich zur Lebensqualität bei.
Unterstützung in der Krankheitsbewältigung
Viele Patientinnen und Patienten erleben während der Therapie Ängste, depressive Symptome oder das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Psychoonkologinnen und -onkologen bieten individuelle Gespräche an, in denen Sorgen ausgesprochen, Strategien entwickelt und Ressourcen gestärkt werden können. Ziel ist es, Patientinnen und Patienten zu befähigen, mit den psychischen Belastungen der Erkrankung umzugehen und ein Stück Normalität zurückzugewinnen. Auch Angehörige finden in der psychoonkologischen Betreuung wichtige Unterstützung, um ihre Rolle zwischen Sorge, Pflege und eigenem Leben zu meistern.
Neue Erkenntnisse und Wirksamkeit
Zahlreiche Studien belegen die positive Wirkung psychoonkologischer Angebote: Sie können Ängste und Depressionen reduzieren, die Krankheitsbewältigung verbessern und die Lebensqualität deutlich erhöhen. Eine multizentrische Studie aus Deutschland zeigte etwa, dass über die Hälfte der Brustkrebspatientinnen und -patienten psychoonkologische Unterstützung in Anspruch nahmen – und diese als entscheidend für ihren Umgang mit der Erkrankung empfanden (Springer Medizin, 2022).
Darüber hinaus empfehlen nationale und internationale Leitlinien, Psychoonkologie als festen Bestandteil der onkologischen Versorgung anzubieten. Die Deutsche Krebshilfe hebt hervor, dass Patientinnen und Patienten ein Recht auf psychosoziale Unterstützung haben, um Ängste zu bewältigen, Hoffnung zu bewahren und die Behandlung aktiv mitzutragen (Patientenleitlinie Psychoonkologie, Deutsche Krebshilfe, 2020).
Ernährung und Diätologie: Mit Kraft durch die Therapie

Eine Krebserkrankung und ihre Behandlung stellen den Körper vor enorme Herausforderungen. Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust oder Verdauungsprobleme sind häufige Begleiter, die den Therapieerfolg beeinträchtigen können. Diätologinnen und Diätologen helfen Patientinnen und Patienten, ihre Ernährung an die veränderten Bedürfnisse anzupassen und dadurch Kraftreserven zu erhalten.
Ernährung als Stütze während und nach der Therapie
Während einer Chemotherapie oder Bestrahlung leiden viele Patientinnen und Patienten unter Geschmacksveränderungen, Übelkeit oder Schluckbeschwerden. Diätologinnen und Diätologen entwickeln in enger Abstimmung mit dem medizinischen Team individuelle Ernährungspläne, die einer Mangelernährung vorbeugen und gleichzeitig die Verträglichkeit der Behandlung verbessern. Nach der Therapie liegt der Fokus darauf, die Ernährungsgewohnheiten wieder zu stabilisieren und die Regeneration zu unterstützen. Eine ausgewogene Kost stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern fördert auch die Lebensqualität und das allgemeine Wohlbefinden.
Neue Erkenntnisse und Empfehlungen
Studien zeigen, dass gezielte Ernährungstherapien die Lebensqualität verbessern und das Risiko therapiebedingter Komplikationen reduzieren können. Eine Analyse aus Deutschland ergab, dass onkologische Patientinnen und Patienten mit individueller Ernährungsberatung seltener unter Mangelernährung leiden und die Behandlung besser vertragen (Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie, 2022).
Auch der Krebsinformationsdienst betont, dass eine ausgewogene Ernährung ein zentraler Baustein ist, um die Nebenwirkungen der Krebstherapie abzumildern und das Risiko für Folgeerkrankungen zu senken (Krebsinformationsdienst, 2023).
Logopädie: Sprache und Schlucken zurückgewinnen

Für viele Krebspatientinnen und -patienten sind die Folgen der Erkrankung nicht nur körperlich spürbar, sondern betreffen auch elementare Fähigkeiten wie das Sprechen oder Schlucken. Besonders nach Tumoren im Kopf-Hals-Bereich kann es zu massiven Einschränkungen kommen. Die Logopädie begleitet Betroffene dabei, ihre Kommunikations- und Schluckfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen – und damit ein Stück Lebensqualität zurückzugewinnen.
Hilfe bei Sprach- und Stimmstörungen
Operationen, Bestrahlungen oder Chemotherapien im Kopf-Hals-Bereich können die Stimme verändern oder die Sprachfähigkeit beeinträchtigen. Logopädinnen und Logopäden entwickeln individuelle Übungen, um die Artikulation zu verbessern, die Stimme zu kräftigen und die Kommunikationsfähigkeit im Alltag zu fördern. Auch moderne Methoden wie computergestützte Sprachtherapien kommen zum Einsatz, um Patientinnen und Patienten in der Rehabilitation zu unterstützen.
Schlucktherapie als zentraler Bestandteil
Ein besonders wichtiges Feld ist die Schlucktherapie. Viele Patientinnen und Patienten leiden nach onkologischen Eingriffen unter Dysphagien – Schwierigkeiten beim Schlucken, die zu Unterernährung, Gewichtsverlust oder sogar Lungenentzündungen führen können. Logopädinnen und Logopäden erarbeiten gezielte Übungen, um die Schluckfunktion zu trainieren und damit eine sichere Nahrungsaufnahme zu ermöglichen. Neuere Studien wie die PREHAPS-Studie am Universitätsklinikum Regensburg zeigen, dass ein frühzeitiges, prätherapeutisches Schlucktraining das Risiko schwerer Schluckstörungen deutlich verringern kann (UKR, 2023).
Logopädie als Teil der onkologischen Versorgung
Die logopädische Therapie endet nicht mit dem Klinikaufenthalt. Sie ist Teil einer langfristigen Begleitung, die Patientinnen und Patienten hilft, ihre Selbstständigkeit und soziale Teilhabe zurückzugewinnen. Leitlinien empfehlen, Logopädie frühzeitig in die onkologische Behandlung zu integrieren, um bleibende Einschränkungen zu verhindern und die Lebensqualität nachhaltig zu sichern (Rosenfluh, 2017).
Kunsttherapie: Ausdruck finden, innere Stärke gewinnen

Eine Krebserkrankung bringt nicht nur körperliche Veränderungen mit sich, sondern konfrontiert Betroffene auch mit intensiven Gefühlen wie Angst, Trauer oder Wut. Kunsttherapie eröffnet Patientinnen und Patienten einen geschützten Raum, in dem sie ihre Emotionen jenseits von Worten ausdrücken können. Farben, Formen und Bilder werden so zu einem Medium der Verarbeitung und helfen, innere Stärke zurückzugewinnen.
Kreativität als Ressource
Während der Therapie bietet die Kunsttherapie Möglichkeiten, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und Kontrolle über den Heilungsprozess zurückzuerlangen. Das Gestalten von Bildern oder Skulpturen kann helfen, Erlebnisse zu verarbeiten, die schwer in Worte zu fassen sind. Für viele Patientinnen und Patienten wird dieser kreative Ausdruck zu einer wichtigen Ressource, um Zuversicht zu entwickeln und Resilienz zu stärken.
Neue Erkenntnisse zur Wirksamkeit
Studien zeigen, dass Kunsttherapie die Lebensqualität von Krebspatientinnen und -patienten verbessern und Stress reduzieren kann. Eine Pilotstudie zur Online-Kunsttherapie für Brustkrebspatientinnen und -patienten belegte, dass auch digitale Formate wirksame Unterstützung bieten können – besonders für Patientinnen und Patienten, die mobil eingeschränkt sind oder in ländlichen Regionen leben (Alanus Hochschule, 2021).
Eine Übersichtsarbeit des IGeL-Monitors betont ebenfalls positive Effekte auf Wohlbefinden und Krankheitsbewältigung, weist aber darauf hin, dass die Studienlage noch ausbaufähig ist und weitere Forschung zur langfristigen Wirksamkeit notwendig bleibt (IGeL-Monitor, 2020).
Ganzheitlicher Bestandteil der Betreuung
Kunsttherapie ergänzt die medizinische und psychologische Behandlung auf einzigartige Weise: Sie stärkt Ressourcen, unterstützt die Krankheitsbewältigung und fördert das seelische Gleichgewicht. Viele onkologische Reha-Kliniken haben sie daher als festen Bestandteil in ihre Programme integriert.
Gemeinsam stark: Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Onkologie
Krebs betrifft den ganzen Menschen – Körper, Seele und Alltag. Um dieser Vielschichtigkeit gerecht zu werden, braucht es mehr als einzelne Therapien: Entscheidend ist das Zusammenspiel verschiedener Fachrichtungen. Physiotherapie, Ergotherapie, Psychoonkologie, Diätologie, Logopädie oder Kunsttherapie entfalten ihre volle Wirkung erst dann, wenn sie Hand in Hand arbeiten.
In interdisziplinären Teams werden individuelle Therapiepläne entwickelt, die nicht nur die medizinische Behandlung ergänzen, sondern Patientinnen und Patienten in allen Lebensbereichen unterstützen. So kann eine Patientin oder ein Patient nach einer Operation gleichzeitig an Mobilität, Alltagskompetenzen und psychischer Stabilität arbeiten – begleitet von Expertinnen und Experten, die ihre Maßnahmen aufeinander abstimmen. Studien zeigen, dass diese ganzheitliche Versorgung die Lebensqualität deutlich verbessert und auch die Chancen auf eine nachhaltige Rehabilitation erhöht.
Lebensqualität als Ziel
Die therapeutische Begleitung in der Onkologie ist weit mehr als eine Ergänzung zur Akutmedizin. Sie bedeutet, Patientinnen und Patienten während und nach der Behandlung nicht allein zu lassen, sondern ihnen auf allen Ebenen Halt zu geben – körperlich, seelisch und sozial. Die enge Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachrichtungen ist dabei der Schlüssel: Sie macht aus einzelnen Bausteinen ein stabiles Fundament, auf dem Patientinnen und Patienten wieder Zuversicht und Lebensqualität aufbauen können.
Header © KI | Freepik




