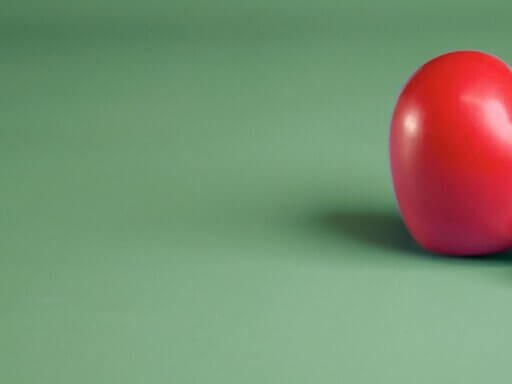Ab 2026 treten in Österreich und Deutschland zahlreiche gesetzliche Neuerungen in Kraft, die unmittelbare Auswirkungen auf den Gesundheits- und Pflegebereich sowie Arbeitsschutz und Versorgungssysteme haben.
Die Gesundheitssysteme in Österreich und Deutschland stehen vor bedeutenden strukturellen Herausforderungen – von demografischem Wandel über Personalengpässe bis zu Kostensteigerungen. Daher bringen beide Länder ab dem Jahr 2026 eine Reihe von gesetzlichen Änderungen auf den Weg, die teils direkt den Gesundheits- und Pflegebereich betreffen, teils indirekt über Arbeits-, Finanz- oder Versorgungsstrukturen wirken. Wir haben die wichtigsten Änderungen für Österreich und Deutschland kompakt zusammengefasst, um dir eine klare Übersicht zu bieten.
Inhalt
- ÖSTERREICH
- DEUTSCHLAND
- Krankenhausfinanzierung: Aussetzung der Meistbegünstigungsklausel
- Krankenkassen: Verwaltungskosten werden begrenzt
- Bundeshaushalt 2026: Mehr Geld für Gesundheit und Pflege
- Pflegekompetenzgesetz: Mehr Eigenverantwortung für Pflegefachkräfte
- Pflegeleistungen: Neue Unterstützung und finanzielle Entlastung für Angehörige
- Elektronische Heilberufsausweise: Neue Generation ab 2026 Pflicht
ÖSTERREICH
Hitzeschutzverordnung: Verbindliche Regeln für Arbeiten im Freien
Ab 01. Januar 2026 tritt in Österreich erstmals eine verbindliche Hitzeschutzverordnung in Kraft. Sie ergänzt die bestehenden Arbeitgeberpflichten nach § 4 ASchG und konkretisiert, welche Gefahren bei Arbeiten im Freien zu beurteilen sind – etwa die Intensität der körperlichen Tätigkeit, die Art der Arbeitskleidung oder das Risiko für besonders gefährdete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Neu ist, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber künftig konkrete Maßnahmen zum Hitze- und UV-Schutz setzen müssen, sobald Geosphere Austria eine Hitzewarnung ab Stufe 2 („Vorsicht, gelb“) ausgibt. Vorrang haben dabei technische und organisatorische Schutzmaßnahmen wie die Verlagerung der Arbeitszeit in kühlere Stunden, Beschattung der Arbeitsplätze oder Wasservernebelungssysteme. Wenn solche Lösungen nicht möglich sind, müssen persönliche Schutzmaßnahmen folgen – etwa leichte Kleidung, UV-Schutzkleidung, Kopfschutz oder kühlende Textilien.
Auch eine Kühlung bzw. Klimatisierung von Krankabinen und selbstfahrenden Arbeitsmitteln wird verpflichtend, mit Übergangsfristen für die Umsetzung. Zusätzlich müssen Notfallmaßnahmen zur Ersten Hilfe bei Hitzebelastungen wie Schwindel, Hitzekrämpfen oder Kreislaufproblemen bereitstehen.
Die Verordnung soll es der Arbeitsinspektion erleichtern, Sicherheitsmängel klar zu erkennen und Betriebe gezielt zu beraten. Gleichzeitig wird die Inspektion in den Sommermonaten einen Schwerpunkt auf hitzegefährdete Branchen legen. Ziel ist es, die Zahl hitzebedingter Erkrankungen deutlich zu senken und die Gesundheit von Beschäftigten langfristig zu schützen.
Pflegearbeit: Offizielle Anerkennung als Schwerarbeit
Ebenfalls ab 01. Januar 2026 gilt in Österreich die Pflegearbeit offiziell als Schwerarbeit. Pflegekräfte, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, können künftig bereits mit 60 Jahren in Pension gehen.
Voraussetzung ist eine Versicherungsdauer von mindestens 45 Jahren, davon mindestens 10 Jahre Schwerarbeit in den letzten 20 Jahren. Neu ist außerdem, dass ein Monat schon dann als Schwerarbeitsmonat zählt, wenn an mindestens 12 Tagen im Schichtdienst körperlich oder psychisch besonders belastende Pflegearbeit geleistet wurde – bisher waren 15 Tage erforderlich. Auch Teilzeitbeschäftigte ab 50 Prozent Arbeitsausmaß können von dieser Regelung profitieren.
Die Schwerarbeitspension richtet sich an Menschen, die über viele Jahre besonders anstrengende Tätigkeiten ausgeübt haben. Der frühere Pensionsantritt ist mit Abschlägen von 1,8 Prozent pro Jahr verbunden, bietet aber eine wichtige Entlastung für Pflegekräfte unter fordernden Arbeitsbedingungen.
Erfasst sind insbesondere diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger, Pflegefachassistentinnen und -fachassistenten sowie Pflegeassistentinnen und -assistenten. Nicht alle Berufe im Betreuungsbereich sind derzeit eingeschlossen – eine mögliche Ausweitung wird politisch noch diskutiert.
Gesundheitsreformfonds: 500 Millionen Euro für bessere Versorgung
Ab 2026 wird ein neuer Gesundheitsreformfonds geschaffen. Der Fonds ist mit 500 Millionen Euro dotiert und soll Versorgungslücken schließen, Wartezeiten verkürzen und die Digitalisierung des Gesundheitssystems vorantreiben.
Finanziert wird der Fonds vor allem durch erhöhte Krankenversicherungsbeiträge von Pensionistinnen und Pensionisten. Das Geld soll gezielt dort eingesetzt werden, wo das System unter Druck steht – im niedergelassenen Bereich, bei der Versorgung in strukturschwachen Regionen sowie in der psychosozialen und frauenspezifischen Gesundheitsversorgung.
Laut Budgetanalyse 2025/26 steigen die staatlichen Ausgaben im Gesundheitsbereich von rund 2,84 Mrd. Euro auf etwa 3,22 Mrd. Euro. Dieser Zuwachs ist maßgeblich auf den neuen Reformfonds zurückzuführen. Das Gesundheitsministerium bezeichnet den Fonds als „entscheidenden Beitrag zu einer besseren Versorgung, zu kürzeren Wartezeiten und zu einem moderneren, digitaleren Gesundheitssystem“.
LKF-Modell 2026: Neue Regeln für die Spitalsfinanzierung
Ein weiterer zentraler Reformbaustein ist die Weiterentwicklung der Leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung (LKF). Der Ständige Koordinierungsausschuss der Bundes-Zielsteuerungskommission hat am 6. Juni 2025 das neue LKF-Modell 2026 beschlossen.
Dieses Modell legt fest, wie Krankenanstalten im stationären und spitalsambulanten Bereich künftig finanziert werden. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen angepasste Bepunktungsregelungen, die Abgeltung von Vorhaltekosten sowie aktualisierte Dokumentationsgrundlagen. Ziel ist eine gerechtere, leistungsbezogene Mittelverteilung und eine bessere Steuerung der Ressourcen im Spitalswesen.
Die vollständigen Unterlagen wurden Ende September 2025 veröffentlicht und sind auf der Website des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGK) abrufbar. Das neue Modell soll Transparenz schaffen und die Finanzierung stärker an Qualität und tatsächlicher Leistung orientieren.
DEUTSCHLAND
Krankenhausfinanzierung: Aussetzung der Meistbegünstigungsklausel
Im Jahr 2026 wird in Deutschland die sogenannte Meistbegünstigungsklausel im Krankenhausbereich ausgesetzt. Damit werden die Zuwachsraten der Landesbasisfallwerte – also der Berechnungsgrundlage für Klinikvergütungen – auf die bundesweit festgelegten Kostensteigerungen laut Orientierungswert begrenzt. Ziel ist es, das Ausgabenwachstum im Krankenhaussektor zu dämpfen und die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu entlasten.
Trotz der Einsparvorgabe bleibt ein Großteil der Kostensteigerungen über die Tarifrefinanzierung abgesichert, sodass Löhne und Gehälter weiterhin vollständig berücksichtigt werden. Die Maßnahme soll etwa 1,8 Milliarden Euro an Entlastung bringen, wobei die Regierung betont, dass dadurch keine Leistungskürzungen für Patientinnen und Patienten entstehen sollen.
Zugleich besteht Einigkeit darüber, dass weitere Leistungsbereiche an die Einnahmenentwicklung gekoppelt werden müssen, um langfristig Beitragssatzstabilität zu erreichen. Im Arzneimittelsektor wird daher eine temporäre Erhöhung des Herstellerrabatts für patentgeschützte Medikamente von sieben auf siebzehn Prozent diskutiert – eine Maßnahme, die die GKV um bis zu drei Milliarden Euro jährlich entlasten könnte.
Krankenkassen: Verwaltungskosten werden begrenzt
Um die angespannte Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen zu stabilisieren, plant der Bundestag 2026 ein umfangreiches Sparpaket. Kernpunkte sind die Begrenzung der Verwaltungsausgaben sowie die zeitweise Halbierung des Innovationsfonds auf 100 Millionen Euro. Gleichzeitig werden die Krankenkassen im Jahr 2026 von ihrer Pflicht zur Mitfinanzierung des Innovationsfonds befreit, was kurzfristig zusätzliche Liquidität schafft.
Darüber hinaus sollen auch Kostensteigerungen bei der Krankenhausvergütung begrenzt werden. Die Maßnahmen dienen dazu, eine drohende Finanzierungslücke von rund zwei Milliarden Euro zu schließen und einen weiteren Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes zu vermeiden.
Das Gesundheitsministerium betont, dass die Reform keine Kürzungen bei den Versichertenleistungen vorsieht, sondern vor allem auf eine effizientere Mittelverwendung und Verwaltungsmodernisierung abzielt.
Bundeshaushalt 2026: Mehr Geld für Gesundheit und Pflege
Der Bundeshaushalt 2026 sieht eine deutliche Aufstockung der Mittel für das Bundesgesundheitsministerium vor. Insgesamt sind 20,1 Milliarden Euro eingeplant – rund 800 Millionen Euro mehr als im laufenden Jahr.
Davon entfallen 16,8 Milliarden Euro auf Zuschüsse an die gesetzliche Krankenversicherung, während die soziale Pflegeversicherung ein Darlehen von 1,5 Milliarden Euro erhält – drei Mal so viel wie 2025.
Gesundheitsministerin Nina Warken betonte im Bundestag, die steigenden Beiträge müssten gebremst werden. Geplant seien strukturelle Reformen in den Bereichen Krankenhauswesen, Apothekenwesen und Notfallversorgung. Gleichzeitig sollen Pflegevorsorge und Cybersicherheit gestärkt werden.
Die Opposition kritisierte hingegen Kürzungen in der Prävention und bei Gesundheitsverbänden als falsches Signal. Aus ihrer Sicht brauche es vor allem mehr Mut zu grundlegenden Strukturreformen – insbesondere bei Arzneimittelpreisen und der Krankenhausfinanzierung.
Pflegekompetenzgesetz: Mehr Eigenverantwortung für Pflegefachkräfte
Mit dem neuen Pflegekompetenzgesetz (PKG) – das sich derzeit aufgrund von Änderungsanträgen noch in einem laufenden Verfahren befindet – will die Bundesregierung die Pflegeberufe ab Januar 2026 deutlich stärken und modernisieren. Das Gesetz gilt als eine der zentralen Reformen im Gesundheitsbereich und soll die Kompetenzen von Pflegefachpersonen erweitern, Bürokratie abbauen und die Pflege als Profession aufwerten.
Pflegekräfte sollen künftig heilkundliche Tätigkeiten eigenständig übernehmen dürfen – etwa die Versorgung chronischer Wunden, die bislang Ärztinnen und Ärzten vorbehalten war. Außerdem können sie Empfehlungen für Pflegehilfsmittel aussprechen und sollen stärker in die Versorgungssteuerung eingebunden werden.
Das PKG sieht zudem eine zentrale Anlaufstelle für Pflegebedürftige und Angehörige sowie die Erprobung neuer Versorgungsformen vor. Damit soll nicht nur die Effizienz im Gesundheitswesen steigen, sondern auch die Attraktivität des Pflegeberufs.
Pflegeleistungen: Neue Unterstützung und finanzielle Entlastung für Angehörige
Parallel zum PKG sind ab 2026 weitere Reformen im Pflegebereich geplant, die insbesondere pflegende Angehörige unterstützen sollen.
Mit dem neuen Familienpflegegeld wird eine Lohnersatzleistung eingeführt, die pflegenden Angehörigen mehr finanzielle Sicherheit bietet. Vorgesehen sind 65 Prozent des letzten Nettoeinkommens, mindestens 300 Euro, höchstens 1.800 Euro monatlich, bei vollständiger oder teilweiser Aufgabe der Erwerbstätigkeit. Der Start ist frühestens Mitte 2026 vorgesehen.
Bereits seit Juli 2025 können Verhinderungs- und Kurzzeitpflege in einem flexiblen Jahresbudget kombiniert werden. Ab 2026 kommen weitere Verbesserungen hinzu:
- Individuellere Verteilung zwischen ambulanter und stationärer Pflege
- Kostenlose Online-Kurse für pflegende Angehörige
- Ausbau der Pflegeberatung durch Kassen und Kommunen
Ein weiteres Kernziel der Reform ist die Begrenzung der Eigenanteile im Pflegeheim. Diese sollen künftig auf maximal 1.000 Euro monatlich gedeckelt werden – ein Schritt, der Pflegekosten kalkulierbarer macht und Familien finanziell entlastet.
Für Haushalte, die auf eine 24-Stunden-Betreuung setzen, bleibt das klassische Pflegegeld erhalten. Das Familienpflegegeld bietet hier eine wichtige Ergänzung, insbesondere für Angehörige, die zeitweise beruflich pausieren.
Elektronische Heilberufsausweise: Neue Generation ab 2026 Pflicht
Ab dem 01. Januar 2026 dürfen elektronische Heilberufsausweise (eHBA) der Generation 2.0 nicht mehr genutzt werden. Grund sind Sicherheitsvorgaben der Bundesnetzagentur, da diese Karten noch auf dem veralteten RSA-2048-Bit-Algorithmus basieren.
Alle betroffenen Karten – insbesondere der Anbieter D-Trust (Bundesdruckerei) und DGN/medisign – müssen daher bis Ende 2025 ersetzt werden. Die neue Kartengeneration eHBA 2.1 nutzt die moderne Elliptic Curve Cryptography (ECC) und gilt als zukunftssicher, leistungsstärker und kompatibel mit der Telematikinfrastruktur.
Der Kartentyp ist auf der Rückseite am Aufdruck rechts oben unter dem CE-Zeichen erkennbar. Für Ausweise der Generation 2.1 ist kein Austausch erforderlich. Mit dieser Umstellung wird ein weiterer Schritt zur IT-Sicherheit und Stabilität der digitalen Gesundheitsinfrastruktur vollzogen.
Header © Proxima Studio | Canva