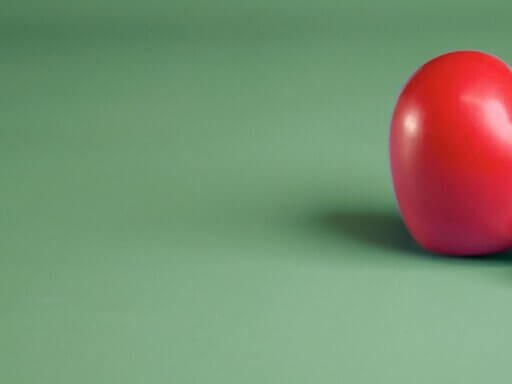Telemedizin bietet TherapeutInnen in Österreich neue Möglichkeiten der Versorgung, erfordert jedoch ein genaues Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen, um sicher und professionell angewendet zu werden.
Die Telemedizin hat sich in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Bestandteil moderner Gesundheitsversorgung entwickelt. Besonders für MTD-Berufe – etwa Physiotherapie, Logopädie, Diätologie oder Ergotherapie – eröffnet sie neue Möglichkeiten der Betreuung, Versorgung und Effizienzsteigerung. Gleichzeitig bringt sie jedoch klare rechtliche Anforderungen mit sich, die sorgfältig beachtet werden müssen. Der folgende Überblick bereitet die wichtigsten berufsrechtlichen, datenschutzrechtlichen, haftungsrechtlichen und organisatorischen Vorgaben verständlich auf und bietet dir eine praxisnahe Orientierung.
Inhalt
Allgemeine Grundlagen der Telemedizin
Telemedizin bezeichnet die Erbringung therapeutischer oder diagnostischer Leistungen über räumliche Distanz unter Nutzung digitaler Kommunikationsmittel – beispielsweise per Video, Telefon oder digitale Plattformen. Ihre Anwendung ist in Österreich nicht durch ein einheitliches „Telemedizingesetz“ geregelt, sondern ergibt sich aus einem Zusammenspiel verschiedener Rechtsbereiche: Berufsrecht, Sozialversicherungsrecht, Datenschutzrecht und teilweise Zivilrecht.
Wichtig ist: Telemedizin bietet Chancen, ersetzt aber nicht automatisch jede Präsenzbehandlung. Sicherheit, Qualität und Patientenschutz stehen immer an erster Stelle.
Berufsrechtliche Rahmenbedingungen in Österreich
In Österreich gibt es kein eigenes Telemedizingesetz. Stattdessen definieren einzelne Berufsgesetze, in welchem Umfang Telemedizin erlaubt ist. Dadurch ergeben sich für unterschiedliche Gesundheitsberufe unterschiedliche Spielräume:
Explizit erlaubt ist Telemedizin bereits für MTD-Berufe wie Physiotherapie, Logopädie, Diätologie, Orthoptik, Ergotherapie, Biomedizinische Analytik u.a.
Ebenfalls ausdrücklich erlaubt ist Teletherapie seit 01. Januar 2025 für Klinische- und GesundheitspsychologInnen (§ 32a PlG 2013), PsychotherapeutInnen (§ 39 PThG 2024) und MusiktherapeutInnen (§ 27a MuthG).
Ärztinnen und Ärzte dürfen seit 01. Januar 2024 Telemedizin berufsrechtlich ausdrücklich anwenden (§ 49 Abs 2 ÄrzteG).
Keine explizite gesetzliche Regelung gibt es weiterhin für Hebammen, TierärztInnen, Heilmasseure sowie Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege. Für diese Gruppen besteht daher weiterhin Rechtsunsicherheit.
Vor den Gesetzesnovellen herrschte die Meinung vor, dass Telemedizin generell zulässig sei, solange sie nicht ausdrücklich verboten ist. Da aber nun einige Berufsgruppen positive Erlaubnisnormen erhalten haben und andere nicht, könnte dies umgekehrt so ausgelegt werden, dass für unbezeichnete Berufe ein Telemedizin-Einsatz nicht zulässig ist.
Für MTD-Berufe besteht diese Unsicherheit jedoch nicht, da Telemedizin hier ausdrücklich erlaubt und etabliert ist.
Datenschutzrechtliche Anforderungen
Telemedizin erweitert die datenschutzrechtlichen Anforderungen erheblich, da sensible Gesundheitsdaten nicht nur gespeichert, sondern auch aktiv übermittelt werden.
Zentrale Rechtsgrundlagen
Gemäß § 6 GTelG 2012 müssen Gesundheitsdaten ausschließlich über gesicherte oder verschlüsselte Kanäle übermittelt werden.
Das bedeutet konkret:
- Keine Befunde oder Bilder über unverschlüsselte E-Mail-Anhänge senden.
- Messenger-Dienste wie WhatsApp sind für die PatientInnen-Kommunikation datenschutzrechtlich ungeeignet.
- Die Ärztekammer Wien rät von unverschlüsselten E-Mails und Messengerdiensten grundsätzlich ab.
- Schriftliche elektronische Behandlungen (z. B. über Chat) gelten im ärztlichen Kontext sogar als unzulässig.
Für Patientinnen und Patienten gilt hingegen: Wenn diese selbständig ungesicherte Kanäle nutzen, liegt die Verantwortung bei ihnen – nicht beim Gesundheitsberuf.
Anforderungen an Telemedizin-Plattformen
Die Plattform muss:
- DSGVO-konform arbeiten,
- Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation bieten,
- auf Servern innerhalb der EU betrieben werden,
- für ärztliche Nutzung idealerweise zertifiziert sein (z. B. Telemed Austria).
Für VertragsärztInnen gibt es zusätzlich die kostenfreie Plattform visit-e, die bereits datenschutzrechtlich geprüft ist.
MTD-Berufe können ebenfalls von zertifizierter Software profitieren – zwar gibt es keine verpflichtende Plattform, aber die gleichen Datenschutzstandards gelten. Tipp: Praxissoftware-Anbieter wie appointmed bieten für Therapeutinnen und Therapeuten praktische und DSGVO-konforme Möglichkeiten für Teletherapie und Videosprechstunden.
Einwilligung, Aufklärung und Haftung
Der Ersttermin mit Patientinnen und Patienten muss immer persönlich stattfinden und vor jeder telemedizinischen Behandlung ist eine ausdrückliche Einwilligung erforderlich. Diese muss beinhalten:
- Aufklärung über Zweck, Ablauf und Grenzen der Telemedizin
- Hinweis auf mögliche technische Störungen
- Einverständnis mit der gewählten Kommunikationsform
- Hinweis, dass eine Präsenzbehandlung jederzeit erfolgen kann
Einwilligungen sollten schriftlich dokumentiert oder digital bestätigt werden.
Haftungsfragen
Haftungsrisiken entstehen insbesondere bei technischen Ausfällen, Datenverlust, unzureichender Bild- oder Tonqualität sowie Fehleinschätzungen aufgrund fehlender körperlicher Untersuchung.
Du solltest daher schriftlich klar regeln, wer wofür verantwortlich ist, wie bei technischen Problemen verfahren wird und welche Grenzen die Telemedizin in Ihrem Setting hat.
Wann ist Telemedizin fachlich sinnvoll?
Telemedizin darf nur angewendet werden, wenn eine Behandlung lege artis, also nach den “Regeln der ärztlichen Kunst”, möglich ist. Die Verantwortung dafür liegt immer beim behandelnden Berufsträger.
Zentrale Entscheidungskriterien
Eine telemedizinische Behandlung ist sinnvoll, wenn:
- Die physische Untersuchung nicht zwingend erforderlich ist (z. B. Verlaufskontrollen, Befundbesprechungen, Übungskontrollen)
- Die PatientInnen-Sicherheit gewährleistet ist.
- Kommunikation und Vertrauen digital aufrechterhalten werden können.
- Technische Voraussetzungen auf beiden Seiten gegeben sind.
- Der/Die PatientIn umfassend aufgeklärt wurde und einwilligt hat.
- Gefahrenbeherrschung auch aus der Distanz möglich ist.
Wann ist Telemedizin ungeeignet?
Telemedizin ist nicht empfehlenswert bei:
- fehlender technischer Kompetenz oder Ausstattung,
- erheblichen kognitiven Einschränkungen (z. B. Demenz),
- akuten Notfällen oder rascher Verschlechterung,
- Situationen, in denen Tastbefunde oder unmittelbare Interventionen notwendig sind.
Der verpflichtende Erstkontakt in Präsenz eignet sich auch, um die Indikation und die telemedizinische Eignung sicher beurteilen zu können.
Erstattung und Abrechnung
Die ÖGK hat telemedizinische Leistungen von Ärztinnen und Ärzten bereits ausdrücklich in ihre Gesamtverträge aufgenommen. Leistungen können gleich vergütet werden wie Präsenzleistungen, vorausgesetzt:
- Einverständnis des/der PatientIn liegt vor.
- Die Behandlung ist berufsrechtlich zulässig.
- Die telemedizinische Leistung ist qualitativ gleichwertig.
- Der/Die PatientIn ist dem Arzt/der Ärztin persönlich bekannt (Erstkontakt in Präsenz, mit bestimmten Ausnahmen).
Nicht abrechenbar sind Terminvereinbarungen und eine rein schriftliche Kommunikation (E-Mail, SMS).
Für MTD-Berufe existieren derzeit keine umfassenden einheitlichen Abrechnungsregelungen. Stattdessen gilt oft das Modell:
- Direkte Verrechnung nicht möglich
- Kostenzuschuss durch die Sozialversicherung nach Vorlage einer Rechnung möglich
Dabei gilt: Telemedizinische Leistungen müssen berufsrechtlich zulässig sein, um erstattungsfähig zu sein.
Praktische Empfehlungen für deine telemedizinische Praxis
1. Verwende ausschließlich DSGVO-konforme, sichere Software.
Achte auf Verschlüsselung, sichere Serverstandorte und Zertifizierungen.
2. Dokumentiere Einwilligung und Aufklärung.
Dies schützt dich rechtlich und schafft Klarheit für die PatientInnen.
3. Lege fest, wann Telemedizin möglich ist – und wann nicht.
Erstelle dafür interne Kriterien oder Checklisten.
4. Sorge für gute technische Qualität.
Stabile Internetverbindung, ruhige Umgebung, funktionierende Kamera und Mikrofon.
5. Halte eine Struktur für Notfälle bereit.
Was tun, wenn der Zustand des Patienten sich während der Sitzung verschlechtert?
6. Prüfe regelmäßig Gesetzes- und Abrechnungsupdates.
Da sich die Telemedizin rasch weiterentwickelt, kann sich die Rechtslage laufend ändern.
Header © Drazen Zigic | Freepik