Sexualtherapeutin Elisabeth Löw spricht über Scham, Beziehungsdynamiken, Digitalisierung und warum Sexualität eines der intensivsten Themen in der Psychotherapie ist.
Sexualität ist weit mehr als nur ein körperliches Bedürfnis – sie ist eng mit unserer Identität, unseren Beziehungen und tief verwurzelten gesellschaftlichen Normen verknüpft. Doch obwohl sie ein zentraler Bestandteil des menschlichen Lebens ist, wird sie oft von Scham, Unsicherheiten und falschen Erwartungen begleitet.
Sexualtherapeutin Elisabeth Löw arbeitet in ihrer Praxis in Wien – derzeit noch in Ausbildung unter Supervision – mit ihren Klientinnen und Klienten genau an diesen Themen. In diesem Interview spricht sie über häufige Anliegen in der Sexualtherapie, die Auswirkungen von Digitalisierung und Social Media auf Beziehungen, gesellschaftliche Veränderungen in der Liebe sowie die Herausforderungen queerer Menschen. Sie erklärt, wie Pornografie das Sexualverhalten junger Menschen verändert, welche Rolle Kommunikation in Partnerschaften spielt und warum Sexualität eines der intensivsten Themen in der Psychotherapie ist. Ein Gespräch über Nähe, Ängste, Vorurteile und den Wunsch nach echter Verbindung.
Wie kann die integrative Gestalttherapie helfen, Blockaden oder Ängste rund um Sexualität und Intimität zu lösen? Welche Rolle spielt der Körper dabei?
Die integrative Gestalttherapie ist prozessorientiert und erlebnisbezogen. Wir arbeiten phänomenologisch, also im Hier und Jetzt – weniger in der Vergangenheit oder in der Kindheit, wie es etwa in der Analyse der Fall ist. Stattdessen fragen wir: Wie wirkt die Vergangenheit noch in der Gegenwart? Und was kann ich jetzt ändern? Die Zukunft existiert noch nicht, die Vergangenheit ist gelebt – entscheidend ist, was bereits integriert ist und womit wir weiterarbeiten können.
Dabei spielt der Körper eine große Rolle: Wir nutzen Malen, Tasten, Bewegung, Tanz, Spiel, Konzentration und Atemübungen – gerade der Atem ist essenziell. Besonders in der Sexualtherapie kann das helfen, weil viele Menschen sich wenig spüren, sehr im Kopf, aber wenig im Körper sind. Und genau da setzen wir an.
Was sind die häufigsten Anliegen, mit denen Menschen zu dir in die Praxis kommen?
Es geht um sexuelle Orientierung und Identität, aber auch um Themen wie Orgasmusstörungen, Erektionsprobleme oder Pornografiesucht – also ein sehr breites Feld. Polyamorie wird ebenfalls immer relevanter. Viele fragen sich, wie sie das für sich leben können, weil sie es eigentlich wollen, aber noch nicht genau wissen, wie – oft auch wegen gesellschaftlicher Erwartungen und der Frage, welchen Zugang sie dazu finden.
Ändern sich nur die Themen weiter oder haben sich im Zuge deiner Ausbildung und deiner therapeutischen Arbeit in den letzten Jahren auch die Methoden und Ansätze verändert?
Die Veränderung passiert eher nur auf Seite der Themen. Die Dating-Welt hat sich durch Apps stark verändert – alles ist schnelllebiger geworden. Die Emanzipation der Frau spielt eine große Rolle: Man braucht keinen Partner oder keine Partnerin mehr zum Überleben, ist aber auch leichter austauschbar. Viele schätzen nicht mehr, was sie haben, sondern wollen immer mehr. Die Erwartungshaltung ist extrem hoch – die perfekte Partnerschaft, der perfekte Job – und Social Media verzerrt das zusätzlich.
Methodisch spezialisiert man sich auf ein Thema und filtert heraus, was für die Klientin oder den Klienten wirklich passt. Wir arbeiten stark am Symptom: Wofür ist jemand offen? Was kann er sich vorstellen? In der Sexualtherapie wird auch immer mehr mit Sexspielzeug und visuellen Methoden gearbeitet, etwa mit VR-Brillen.
Gibt es Missverständnisse zum Thema Sexualtherapie, die dir oft begegnen?
Ja, absolut. Sexualität ist nach wie vor ein schambesetztes, tabuisiertes Thema. Viele denken, wenn sie zur Sexualtherapie kommen, müsse etwas mit ihrem Körper nicht stimmen – oder ihre Neigung sei „zu pervers“ und gehöre verboten oder bestraft.
Dabei ist es eine große Herausforderung, die eigene Sexualität nicht ausleben zu können, weil vieles gesellschaftlich nicht akzeptiert oder toleriert wird. Man vergleicht sich auch ständig. Besonders Paare kommen oft ungern, weil sie sich fragen: „Wie kriegen es andere hin? Was stimmt bei uns nicht?“ Meistens geht es bei der Sexualität bei Paaren gar nicht um Technik, sondern um die Frequenz – einer will mehr, der andere weniger. Und genau daran scheitert es oft, denn viele definieren sich stark über ihre Sexualität, was schnell zu Minderwertigkeitsgefühlen führen kann.
„Sexualität ist die intimste Form der Kommunikation – wenn sie im Alltag nicht funktioniert, dann auch nicht im Bett.“
Ist es auch so, dass viele Paare eine Therapie als letzten Schritt sehen und deshalb oftmals erst sehr spät damit beginnen?
Viele Paare kommen tatsächlich erst sehr spät und legen das Problem dann einfach bei der Therapeutin oder beim Therapeuten ab – so nach dem Motto: „Mach du mal.“ Aber wir begleiten nur. Gehen muss den Weg jede und jeder selbst. Gerade in der Gestalttherapie geht es darum, dass der Mensch seinen eigenen Weg spürt und ihn wirklich selbst gehen will. Wenn das nicht da ist, kommt auch nichts an. Und ohne echte Bereitschaft, wenn der Wille fehlt, bringt selbst die beste Therapie und auch eine gute therapeutische Beziehung nichts.
Du hast davon gesprochen, dass das Thema Sexualität oft sehr schambesetzt ist. Wie gehst du mit Menschen um, die eben diese Scham oder diese negativen Glaubenssätze haben, was ihre Sexualität betrifft?
Zuerst explorieren wir – also schauen uns die Biografie an, woher das kommen könnte. In der Gestalttherapie geht es aber weniger ums Warum, sondern mehr ums Wie. Wie ist es entstanden? Wie zeigt es sich jetzt? Was ist da? Denn unser Leitsatz ist: Alles, was ist, darf sein. Es gibt nichts, was ohne Grund da ist, und es wird nicht bewertet.
Wichtig ist, ressourcenorientiert zu arbeiten. Welche Stärken hat die Klientin oder der Klient, um Scham und negative Gedanken zu überwinden? Gerade Scham und Schuld sind extrem starke Gefühle – oft stärker als Wut oder Ärger – und treten fast immer gemeinsam auf. Viele fühlen Schuld, obwohl sie eigentlich gar keine tragen. Es geht also auch darum, zu erkennen, wo diese Schuld gar nicht zum Klienten gehört.
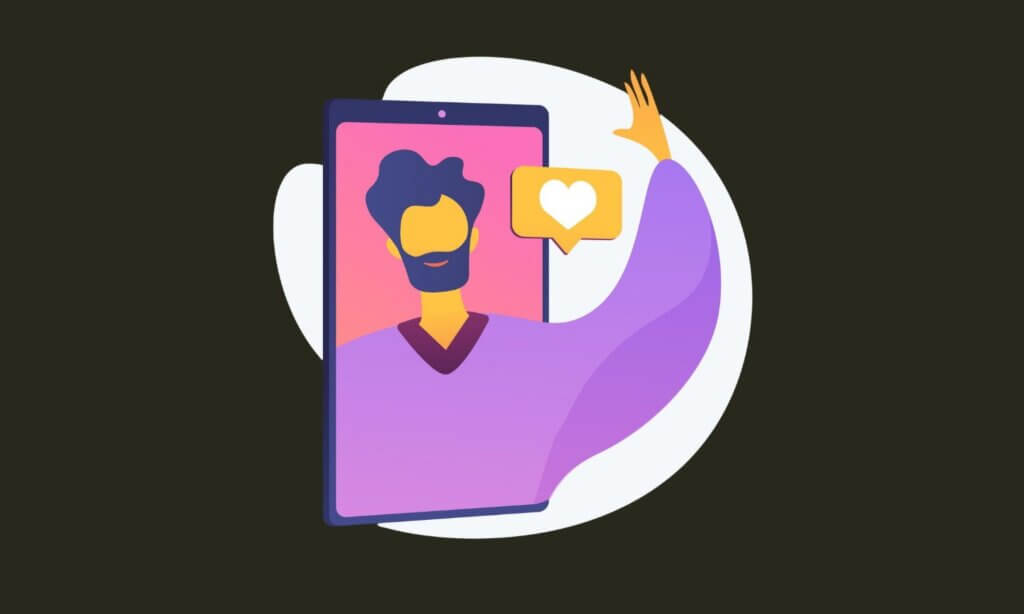
Ein anderer Punkt, den du eben angesprochen hast, sind Dating-Apps. Wie hat sich angesichts dessen das Verständnis von Liebe und Partnerschaft verändert?
Es wird weniger oder später geheiratet, und auch der Kinderwunsch verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt im Leben bzw. wollen viele gar keine Kinder mehr. Die Unabhängigkeit spielt eine große Rolle: Man kann immer wieder neu anfangen und ist auf niemanden angewiesen. Gleichzeitig gibt es oft die Erwartung, dass vielleicht noch etwas Besseres kommt. Bei Dating-Apps ist der nächste potenzielle Partner ja nur einen Klick entfernt.
Ich habe das Gefühl, Menschen treffen sich schneller und sortieren auch schneller aus. Dating fühlt sich oft wie ein Wettbewerb an, man wird ständig verglichen. Viele Klientinnen und Klienten sagen mir, dass sie es nach ein paar Monaten einfach nur erschöpfend finden. Und für manche kann es sogar zur Sucht werden – sie brauchen für jede Unternehmung ein Date, statt einfach mit Freundinnen und Freunden ins Kino oder Theater zu gehen. Letztlich steckt dahinter oft die Suche nach Bestätigung, aber eben nicht aus dem Freundeskreis, sondern von romantisch interessierten Menschen. Denn Sucht ist immer eine Suche nach etwas.
Digitalisierung, Social Media, Feminismus, das 4B-Movement aus Korea – es gibt viele gesellschaftliche, technische und soziokulturelle Einflüsse auf Liebe, Partnerschaft und Sexualität. Was prägt deiner Meinung nach aktuell am stärksten?
Ich denke, die Digitalisierung spielt eine große Rolle, aber auch Corona hatte einen starken Einfluss. Nach der langen Zeit zuhause ist das Dating explodiert – viele hatten Verlustängste. Ich sehe auch, dass FOMO, also „Fear of missing out“, eine sehr große Rolle spielt. All das führt dazu, dass viele Menschen Beziehungen mittlerweile wie Produkte konsumieren: Passt es nicht mehr, wird es ausgetauscht.
Auch das Thema Selbstoptimierung wird durch die Digitalisierung immer extremer. Das gibt es zwar schon lange, aber Social Media verstärkt es enorm – durch Hobby-Psychologinnen und -Psychologen, die erzählen, dass man alles allein schaffen muss, Selbstverwirklichung über alles. Dabei geht es immer mehr nur um sich selbst, und genau das ist nicht der richtige Weg.
„Viele denken, das, was sie in Pornos sehen, sei Realität – und das verändert die Erwartungen an Sexualität massiv.“
Weil Sie es zu Beginn kurz erwähnt haben und es auch in Verbindung mit Digitalisierung steht: Inwieweit spielt der intensive Konsum von Pornographie oder sogar eine Sucht danach eine Rolle, was die Erwartungen an Sexualität in Partnerschaften oder auch beim Dating anbelangt? Wer kommt mit diesem Problem vorwiegend zu Ihnen und was macht es mit den Menschen?
Intensiver Pornokonsum beeinflusst das Sexualverhalten massiv. Ich sehe das vor allem bei jungen Klientinnen und Klienten und hier in erster Linie bei jungen Männern. Viele denken, das, was sie in Pornos sehen, sei Realität, und Frauen würden genau das wollen. Besonders problematisch ist, dass Gewalt in Pornos stark zugenommen hat. Menschen suchen oft nach Reibung, wenn sie ihr eigenes Leben als trist oder ereignisarm empfinden, und steigern sich dann in immer extremere Inhalte.
Ich sehe oft junge Männer, die mit Erektionsproblemen oder Unsicherheiten kommen, weil Pornos ihre Vorstellung von Sexualität völlig verzerrt haben. Sie denken, gewisse Praktiken seien „normal“, erwarten sie von ihren Partnerinnen – ohne vorher zu fragen, ob diese das wollen. Der freie Zugang zu solchen Inhalten verschiebt die Wahrnehmung schon in jungen Jahren. Früher hatte man als Kind oder Teenager kaum bis keinen Zugang zu solchen Webseiten. Heute braucht man den meisten Zwölfjährigen keine Begrifflichkeiten in diesem Kontext mehr zu erklären. Heute beginnen viele schon mit acht Jahren, intensiv Pornos zu konsumieren. Manche den halben Tag lang. Besonders gefährdet sind Kinder, die viel Zeit alleine verbringen.
Filme wie „Fifty Shades of Grey” verstärken solche Entwicklungen mitunter, aber vor allem mit Plattformen wie OnlyFans hat sich das Problem weiter verschärft. Pornografie ist jetzt nicht mehr nur auf speziellen Webseiten, sondern auf Social Media angekommen. Der Übergang zwischen „normalem“ Content und expliziten Inhalten ist fließend. Wenn bekannte Influencerinnen und Influencer oder Schauspielerinnen und Schauspieler plötzlich dort vertreten sind, vermittelt das jungen Menschen: Das ist völlig normal. Diese Verwischung der Grenzen führt dazu, dass viele gar nicht mehr reflektieren, welchen Einfluss das auf ihr eigenes Bild von Sexualität hat.
Du hast zuvor erwähnt, dass die sexuelle Orientierung eine wichtige Rolle in deinen Gesprächen mit Klientinnen und Klienten spielt. Mit welchen Anliegen kommt die LGBTIQ+ Community am häufigsten zu dir?
Ein großes Thema ist die Herkunft – kulturelle Prägung spielt eine große Rolle. Aber auch Politik und Religion sind zentral. Letzteres speziell bei Klientinnen und Klienten, die beispielsweise bei den Großeltern aufgewachsen sind oder wo diese nach wie vor die engsten Bezugspersonen sind. Gesellschaftlicher Druck ist ebenfalls enorm. So werden homosexuelle Paare etwa, wenn sie in der Öffentlichkeit ihre Liebe zeigen, durch Händchenhalten oder Küssen, nach wie vor komisch angesehen oder sogar angegriffen.
Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die mir erzählt hat, dass ein trans* Pärchen von mehreren Therapeutinnen und Therapeuten abgelehnt wurde – mit der Begründung: „Das bringt ja nichts.” Besonders gegenüber trans* Personen gibt es nach wie vor viele Vorurteile und sie haben es im Dating-Bereich oft besonders schwer. Es gibt immer wieder Menschen, vor allem aus dem heterosexuellen Bereich, die eine einmalige Erfahrung mit einer trans* Person machen wollen – aber eben nur als Experiment. trans* Personen suchen jedoch natürlich genau wie jede und jeder andere auch echte Beziehungen, Liebe und Verbundenheit. Oftmals als „exotisches Abenteuer” gesehen zu werden, ist verletzend und kann die Fähigkeit, Vertrauen zu schenken, zunehmend einschränken.
Ein weiteres großes Thema ist die sexuelle Identität. Besonders von Jugendlichen höre ich hier oft von einer großen Verunsicherung. Es gibt im Bereich der sexuellen Identitäten mittlerweile sehr viele Begrifflichkeiten, die bei manchen in dieser Phase der Selbstfindung zusätzlich für Verwirrung sorgen. Manche behandeln bestimmte Bezeichnungen auch wie einen Trend und orientieren sich beispielsweise an der sexuellen Identität eines Stars, den sie bewundern. Für viele Menschen ist eben diese sexuelle Identität aber tatsächlich ihre Lebensrealität und Vermischungen können dazu führen, dass die breite Masse manche Identitäten nicht mehr ernst nimmt. Hier gilt es aufzuklären und gemeinsam mit den jungen Klientinnen und Klienten den ganz persönlichen Weg und die eigene Identität zu erkunden.
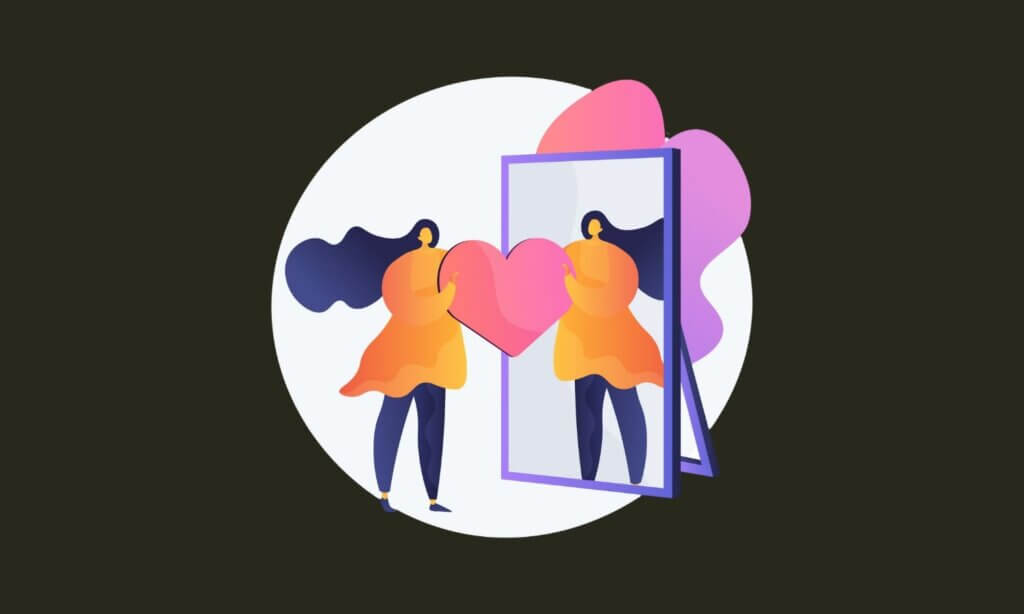
Inwiefern beeinflussen gesellschaftliche Normen und Vorurteile noch immer die sexuelle Selbstwahrnehmung von queeren Menschen und wie kann die Gestalttherapie dabei helfen?
Für viele queere Menschen ist es schwierig, weil sie oft das Gefühl haben, sie dürfen nicht einfach so sein, wie sie sind. Sie haben Angst, andere zu enttäuschen – Eltern, Familie, Umfeld. Und obwohl sich in Schulbüchern und im Pride Month viel tut, bleibt oft dieses unterschwellige Gefühl: „Irgendwas ist vielleicht nicht ganz richtig.“
In der Therapie geht es darum, dieses „Richtig“ zu hinterfragen. Wer sagt, was richtig ist? Kommt das von einem selbst oder von außen? Diese Fragen helfen, schneller zur eigenen Identität zu finden. Ich lasse meine Klienten oft ihre innere und äußere Version von sich selbst malen – zum Beispiel „die innere und die äußere Elisabeth“. Wie sieht die innere Elisabeth die Welt? Was sind ihre Werte? Und wo gibt es Widersprüche zwischen der eigenen Wahrnehmung und der Realität? Denn jeder lebt in seiner eigenen Welt, und oft muss man erst erkennen, welche Einflüsse wirklich von außen kommen – und welche nur übernommen wurden.
Gibt es besondere Herausforderungen für nicht-binäre oder trans* Personen in Bezug auf Sexualität und Beziehungen?
Religion und Politik spielen eine große Rolle, auch wenn ich das in der Therapie nicht in den Fokus rücken möchte. Aber ich merke, dass die Menschen immer mehr darüber sprechen müssen – vor allem aus Angst. Gerade in der queeren Community ist diese Angst stark spürbar, besonders angesichts von politischen Veränderungen.
Es beeinflusst den Alltag enorm. Wenn jemand non-binär ist, stellt sich die Frage: Wie zeige ich mich der Welt? Wie viel gebe ich preis? Und vor allem: Wie fühlt sich meine Identität für mich an? Denn am Ende geht es immer ums Spüren – um das eigene Erleben.
Wie erlebst du den Umgang der Gesellschaft mit queeren Themen – insbesondere seitens älterer Generationen? Denkst du, dass Angst dabei eine große Rolle spielt?
Gerade in gesellschaftlichen und politischen Debatten sieht man, dass alles Fremde Angst macht. Besonders die ältere Generation setzt sich oft gar nicht mehr mit queeren Themen auseinander – teils, weil sie es nicht mehr müssen, teils, weil es früher komplett unterdrückt wurde. Meine 90-jährige Oma hat mir zum Beispiel erzählt, dass es in ihrem kleinen 100-Seelen-Dorf, als sie jung war, auch einen Mann gab, der sich als Frau gekleidet hat. Aber damals wurde die Person einfach als „verrückt“ abgestempelt, ohne dass man sich wirklich damit auseinandergesetzt hat.
Heute müssen sich die Menschen damit beschäftigen – spätestens, wenn sie Veranstaltungen rund um den Pride Month in den Städten mitkriegen. Und das löst bei vielen Unsicherheiten aus. Es braucht da meiner Meinung nach viel mehr niederschwellige Aufklärung. Denn wir alle entscheiden – sowohl politisch als auch rechtlich und gesellschaftlich – mit darüber, wie das tägliche Leben für Menschen der LGBTIQ+ Community aussieht.
Gehen wir zum Thema Partnerschaft: Was sind die häufigsten Herausforderungen, mit denen Paare zu dir kommen?
Das größte Problem ist, dass viele Menschen nicht mehr miteinander kommunizieren. Bei Paaren betrifft diese nicht vorhandene Kommunikation vor allem die Sexualität. Viele kommen sogar alleine in die Therapie, aber wenn es um die gemeinsame Sexualität geht, bringt das wenig. Oft gibt es Schuldzuweisungen, und wenn der Sex nicht mehr passt, stimmt meist auch die Beziehung nicht mehr.
Sexualität ist die intimste Form der Kommunikation – und wenn diese im Alltag nicht funktioniert, dann auch nicht im Bett. Viele sprechen nicht über ihre Wünsche und Erwartungen, sondern unterdrücken sie, bis sich so viel aufgestaut hat, dass es eskaliert. Manche sehen die Partnerin oder den Partner an diesem Punkt dann schon als „Feind im eigenen Bett“.
In der Therapie geht es darum, wieder miteinander in Verbindung zu kommen: Berührung, Wertschätzung, das Verständnis füreinander und dafür, dass Intimität auch auf so vielen anderen Ebenen stattfindet. Ebenen, die auch für die tatsächliche gemeinsame Sexualität wichtig sind. Es geht aber auch darum, dass jede und jeder in der Beziehung ihre oder seine eigene Sexualität hat. Manche denken beispielsweise, Selbstbefriedigung sei „falsch“ in einer Partnerschaft. Für manche fühlt es sich an, als würde man die Partnerin oder den Partner betrügen. Dabei geht es um eine gesunde Balance zwischen der eigenen Sexualität und der gemeinsamen.
„Gerade in dieser schnelllebigen Zeit sehnen sich viele nach etwas Festem, nach Tiefe und Beständigkeit.“
Gibt es eine Veränderung in den Erwartungen an Beziehungen und Partnerschaften?
Es ist ein enormer Druck dahinter. Romantische Beziehungen wirken heute oft viel pragmatischer – es geht weniger um gemeinsames Wachsen, sondern mehr um: “Wenn du das nicht machst, bin ich weg.” Es wird in der Kommunikation mit der Partnerin oder dem Partner viel häufiger gedroht. Jede und jeder in solchen Konstellationen will ihre oder seine Bedürfnisse durchsetzen, oft kompromisslos.
Da kommen wir wieder auf das Thema FOMO zurück, das wir bei den Dating-Apps hatten: Ich sehe bei meiner Arbeit, dass die Tendenz immer mehr dahin geht, dass man aus einer Angst, etwas zu verpassen, oder dass da noch jemand sein könnte, der besser zu einem passt, eine fehlende Wertschätzung hat für das, was ist. Es ist auch immer weniger Bereitschaft da, an bestehenden Beziehungen zu arbeiten. Heute richtet sich der Fokus stärker nach innen, auf das Selbst – was natürlich auch wichtig ist –, aber es führt oft dazu, dass man sich von der Partnerin oder vom Partner entfremdet.
Ich höre in diesem Zusammenhang sehr oft: „Wir haben uns auseinandergelebt.“ Aber was bedeutet das eigentlich? Wo genau passiert diese Entfernung? Meistens auf einer Ebene, die sich die Menschen selbst nicht erklären können, wo sie keinen Zugang zu sich haben. Da arbeite ich zum Beispiel gern mit Träumen. In Träumen verarbeitet das Gehirn vieles, was im Alltag keinen Platz hat. An viele Träume erinnert man sich nicht bewusst – was auch nicht schlecht ist, weil das Hirn das sozusagen automatisch regelt. Aber oftmals weiß man nach dem Aufwachen doch noch einiges, vor allem, wenn es um wiederkehrende Themen geht. Viele meiner Klientinnen und Klienten führen Traumtagebücher, und wir arbeiten damit. Da kommen oft Dinge ans Licht, die ihnen vorher gar nicht bewusst waren.
Wir haben ja zuvor nicht nur über FOMO, sondern auch über Digitalisierung, Social Media etc. geredet. Ist im Zusammenhang mit Partnerschaften auch das immer präsentere Prinzip der „instant gratification” ein Problem?
Ja, ich sehe in meiner Arbeit, dass Beziehungen heute oftmals viel schneller ablaufen. Man kommt und zieht schneller zusammen – und dann dieser ständige Vergleich. Nicht nur mit den Partnerschaften in der direkten Umgebung, sondern auch mit Beziehungen, die man auf Social Media sieht. „Aber die haben schon ein Kind.“ „Die sind schon verheiratet.” Viele sind gar nicht mehr bei sich, sondern projizieren ihre Beziehung total nach außen. Die Beziehung wird oftmals zum Statussymbol: Hauptsache nicht allein, Hauptsache vergeben, dann ist alles gut.
Aber das ist es eben nicht. Ein Mensch allein kann nie all das erfüllen, was man sich eigentlich von sich selbst wünscht. Glücklich wird man nicht durch einen anderen Menschen. Beziehungen sollten nicht von Erwartungen erdrückt werden, sondern darum gehen, schöne Momente zu teilen. Klar, eine gewisse Erwartungshaltung gibt es immer, aber wenn sie zu groß wird, erzeugt sie enormen Druck. Und dann scheitert es oft genau daran.
Viele bauen sich ein Bild auf, wie eine Beziehung „sein muss”, vergleichen mit früheren Beziehungen, aber vergessen dabei, dass jede Partnerschaft aus zwei Individuen besteht, die Nähe und Verbindung auf ganz eigene Weise leben. In der Therapie schaue ich mir dann auch jede einzelne Beziehung meiner Klienten an – denn oft wiederholen sich Muster. Und viele übernehmen unbewusst genau das, was sie beispielsweise in der Ehe ihrer Eltern gesehen haben.
Zusätzlich zu diesen fixen Vorstellungen wie „Bis 30 muss ich verheiratet sein” oder „Nach ein paar Monaten muss man zusammenziehen” kommt noch dazu, dass sich gerade die Geschlechterrollen sehr verändern. Viele wissen gar nicht mehr, wie sie sich in Beziehungen positionieren sollen, weil alte Muster und Definitionen nicht mehr greifen bzw. vom Gegenüber nicht mehr so leicht akzeptiert werden.
Sind monogame romantische Liebe oder auch die Ehe ein zeitloses Konzept, oder werden sie sich deiner Meinung nach weiterentwickeln?
Auch wenn mittlerweile weniger Menschen heiraten als früher, glaube ich, dass die monogame Beziehung und auch die Institution der Ehe, so wie wir sie heute kennen, noch lange bestehen werden. Gerade in dieser schnelllebigen Zeit sehnen sich viele nach etwas Festem, etwas mit Gewicht, mit Tiefe und Verbindlichkeit. Je weiter die Digitalisierung voranschreitet, desto mehr spüre ich diesen Gegentrend: Menschen wollen wieder Ursprüngliches, setzen auf Selbstversorgung, langsame, handwerkliche Hobbys und auch Spiritualität spielt für viele eine große Rolle. Auch in Beziehungen zeigt sich das – dabei ist es allerdings egal, ob monogam oder poly: Es geht weniger um Oberflächlichkeit, man sucht mehr Beständigkeit. Der Mensch sucht Sicherheit, und die findet er in seinen Beziehungen – in welcher Form auch immer.

Weil du gerade das Thema Polyamorie angesprochen hast: Welche Unsicherheiten und Konflikte begegnen dir in der Therapie in diesem Bereich?
Es gibt natürlich noch viele Vorurteile gegenüber polyamoren Beziehungen – ähnlich wie bei anderen neuen Beziehungsmodellen, wobei Polyamorie eigentlich nichts Neues ist. In der Antike war das völlig normal, erst mit dem Mittelalter wurde die Monogamie zum Standard. Viele sehen es heute nur als Trend, weil es öfter in Serien oder Filmen vorkommt. Aber für viele ist es eine echte Lebensweise, die Sicherheit gibt, da man nicht nur einen Partner oder eine Partnerin hat, sondern sozusagen ein Netzwerk an Partnerinnen und Partnern. Trotzdem geht es um Tiefe, um Verbindlichkeit.
Es wird oft falsch dargestellt, als wären das nur unverbindliche Beziehungen oder eine wilde Kommune – dabei gibt es bei den meisten mit diesem Lebensmodell klare Strukturen. Manche haben eine Hauptpartnerin oder einen Hauptpartner, mit dem sie zum Beispiel eine Wohnung kaufen, haben aber trotzdem noch andere Beziehungen. Kommunikation ist dabei essenziell, Eifersucht oft das größte Thema, das zum Problem wird. Aber gerade in diesen Beziehungen wird viel geredet, viel aufeinander geachtet. Es ist nicht einfach, „jeder macht, was er will“. Viele denken auch, dass man in solchen Konstellationen auf Aspekte wie das Kinderkriegen verzichten muss. Aber in vielen Poly-Beziehungen wird gemeinsam Verantwortung für die Kinder übernommen, was eigentlich sogar mehr dem bekannten Prinzip „It takes a village” entspricht. Es gibt also auch in diesen Modellen Verantwortung und Stabilität. Und eigentlich – wenn man es biologisch betrachtet – ist der Mensch eher für die Polyamorie als für die Monogamie gemacht.
Nach all den Aspekten, die wir besprochen haben, abschließend gefragt: Warum ist das Thema Sexualität – und alles, was dazu gehört – so komplex und beschäftigt uns Menschen so intensiv?
Sexualität ist, meiner Meinung nach, neben dem Tod das intensivste Thema in der Psychotherapie. Sigmund Freud hat das schon mit Eros und Thanatos beschrieben – die beiden stärksten Kräfte im Leben. Diese Gegenspieler sind extrem intensiv und tief im menschlichen Erleben verankert.
Ich fand es zum Beispiel spannend: Als die Queen von England gestorben ist, haben alle meine Klientinnen und Klienten – egal wegen welcher Themen sie bei mir sind – nur noch über ihren Tod und den Tod im Allgemeinen gesprochen. Daran sieht man, wie stark solche Ereignisse als Projektionsfläche dienen. Menschen, die wichtig für die Welt und auch für uns persönlich immer allgegenwärtig waren – obwohl wir sie gar nicht persönlich kennen –, lösen Verlustängste aus, wenn sie plötzlich nicht mehr da sind. Das ist ähnlich wie in der Sexualität: Da geht es auch oft um Verlust, um Angst, um die Frage, was bleibt, wenn etwas oder jemand verschwindet.
Diese Themen sind tief, sie treffen Menschen existenziell. Gleichzeitig sprechen sie aber sehr ungern darüber. Man muss sie oft erst langsam herausholen, weil es genau die Dinge sind, vor denen sich die Menschen am meisten fürchten.
Header © beigestellt




