Gendermedizin richtet den Blick auf die medizinischen Unterschiede von Frau und Mann und hinterfragt darüber hinaus auch generell den einseitigen Blick der Medizin. Univ.-Prof.in Dr.in Margarethe Hochleitner gibt spannende Einblicke in ihren Fachbereich und spricht über Chancen, Defizite und dringend nötige Veränderungen.
Lange Zeit war der Mann in der Medizin das Maß aller Dinge. Genauer gesagt: der weiße, europäische Mann. Mit teils fatalen Folgen für Frauen, Trans- und Intergeschlechtliche sowie alle anderen Menschen, die nicht in dieses „Maß aller Dinge” hineinfielen. Die Gendermedizin arbeitet mittlerweile seit Jahrzehnten daran, dieses Maß zu erweitern, um eine inklusive und diverse Gesundheitsversorgung für alle Menschen in allen Fachbereichen der Medizin möglich zu machen.
Univ.-Prof.in Dr.in Margarethe Hochleitner ist nicht nur habilitierte Kardiologin, sondern auch international anerkannte Expertin auf dem Gebiet der Gendermedizin. Als Direktorin des Frauengesundheitszentrums an den Innsbrucker Universitätskliniken und Leiterin der Koordinationsstelle für Gleichstellung, Frauenförderung und Geschlechterforschung der Medizinischen Universität Innsbruck kämpfte sie mit viel Leidenschaft dafür, dass die geschlechtersensible Medizin in der akademischen Ausbildung fix verankert wird. Ein Thema, bei dem die Medizinische Universität Innsbruck innerhalb Österreichs eine Vorreiterrolle innehat. So war sie beispielsweise 2007 die erste österreichische medizinische Hochschule, die das Fach Gendermedizin als Pflichtlehre aufgenommen hat.
In diesem Gespräch spricht die Pionierin der geschlechtersensiblen Medizin über jahrzehntelange Widerstände, Forschungslücken sowie Inklusion und wagt einen Ausblick in die Zukunft der Gendermedizin.
Könnten Sie uns zum Einstieg kurz erklären, was genau unter Gendermedizin zu verstehen ist und warum sie so wichtig ist?
Gendermedizin beschäftigt sich mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Medizin. Ursprünglich wurde sie als Unterscheidung zwischen Männern und Frauen verstanden, inzwischen umfasst sie aber auch diversitätssensible Aspekte. Lange Zeit wurde in der Medizin davon ausgegangen, dass eine Behandlung für alle gleich funktioniert. Doch das ist nicht der Fall: Krankheiten manifestieren sich unterschiedlich, Medikamente wirken verschieden, und Diagnosen werden oft auf Basis eines männlichen Standardmodells gestellt.
Wie sind Sie persönlich zur Gendermedizin gekommen? Was hat Ihr Interesse daran geweckt?
Ich bin seit jeher Feministin. In meiner Familie waren die Frauen über Generationen hinweg engagiert. Als ich in der Medizin begann, wurde schnell klar, dass Frauen nicht nur unterrepräsentiert, sondern oft auch unerwünscht waren. Die wenigen, die es geschafft hatten, eine fachärztliche Ausbildung zu durchlaufen, verschwanden oft wieder aus dem System. Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit in der Chirurgie: Es gab praktisch keine Oberärztinnen. Ich fragte mich damals oft, wo all die Frauen hin verschwunden waren. Es war offensichtlich, dass es strukturelle Barrieren gab. Diese Ungleichheiten haben mich motiviert, mich tiefer mit geschlechtsspezifischer Medizin auseinanderzusetzen.
Mein Interesse an der Gendermedizin wuchs dann weiter, als ich sah, dass viele medizinische Erkenntnisse nicht auf Frauen übertragen wurden, sondern stattdessen auf die Psyche geschoben wurden. Gerade bei unspezifischen Beschwerden hieß es oft, es sei „psychosomatisch“ oder „stressbedingt“. Ich fand es empörend, dass Patientinnen mit realen körperlichen Beschwerden oft nicht ernst genommen wurden.
Am Anfang gab es den Aufschrei, dass das nicht zu schaffen und viel zu aufwändig ist. Ich kann mich noch erinnern, dass mir ein Kollege aus der Veterinärmedizin immer wieder Röntgenaufnahmen gezeigt hat, die ich sehr interessant fand. Vor allem, wenn sich herausstellt, dass auf dem Bild eine Giraffe zu sehen ist, die sich den Hals verrenkt hat. Da kam mir damals der Gedanke: Er muss von Giraffe bis Klapperschlange, von Maus bis Elefant die unterschiedlichsten Tiere aus verschiedensten Tiergruppen untersuchen und Röntgenaufnahmen bewerten und wir in der Humanmedizin machen ein riesiges Theater, wenn wir zwischen Frau und Mann unterscheiden müssen. Das kann nicht sein.
Welche spezifischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Medizin werden häufig übersehen?
Es gibt zahlreiche gravierende Unterschiede. Zum Beispiel im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Frauen zeigen oft andere Symptome als Männer, aber die Lehrbücher basieren primär auf männlichen Patienten. Auch bei Medikamenten gibt es Unterschiede, denn Frauen haben andere Hormonspiegel, andere Stoffwechselraten und reagieren anders auf Dosierungen. Aufgrund ihres Immunsystems reagieren Frauen oft stärker auf Medikamente, doch oft werden ihre Unverträglichkeiten und Nebenwirkungen als übertrieben abgetan.
Auch im Bereich der Orthopädie gibt es gravierende Unterschiede. Die Anatomie von Frauen und Männern ist nicht identisch: Frauen haben beispielsweise ein breiteres Becken, was sich auf die Haltung und die Belastung der Gelenke auswirkt. Dennoch wurde lange Zeit nicht berücksichtigt, dass Implantate, etwa für Knie- oder Hüftoperationen, oft für den männlichen Körper standardisiert wurden.
„Frauen wurden in der Medizin lange nicht nur übersehen, sondern oft bewusst ignoriert. Viele Beschwerden wurden einfach auf die Psyche geschoben.”
Wie gut ist die Gendermedizin aktuell in Österreich etabliert?
Leider noch nicht gut genug. Der Begriff „Gendermedizin” ist in der öffentlichen Wahrnehmung schwierig, da er oft mit politisch aufgeladenen Debatten verknüpft wird. Zudem gibt es große Widerstände gegen Veränderungen im medizinischen System. Es ist eine meiner gescheiterten Jugendhoffnungen, dass sich mit dem Wechsel auf eine neue Generation in diesem Bereich etwas ändern wird. Als ich als Medizinerin begonnen habe, dachte ich: Wenn die alte Generation weg ist, dann können wir mit dem Thema Gendermedizin weiterkommen. Aber mit denen, die danach kamen, ging gefühlt noch weniger weiter, da sie sich, im Gegensatz zu den „Alteingesessenen”, die das Thema schlichtweg ignoriert haben, von Gendermedizin und dem Raum, den das Thema einnehmen könnte, bedroht gefühlt haben.
Viele halten am Status quo fest und sehen keinen Anlass, etwas zu ändern bzw. wählen lieber das alte Übel, denn bei neuen Dingen weiß man ja nie so recht, was auf einen zukommt. Fortschritte gibt es in einzelnen Fachbereichen, aber flächendeckend ist noch viel zu tun. Ähnliche Probleme haben alle, die die Präventivmedizin voranbringen möchten. Da ist auch immer die Sorge da, dass es komplizierter und teurer wird. Auch die Patientinnen und Patienten selbst tragen einen gewissen Teil dazu bei, dass sich am Status quo z. B. in Bezug auf die Präventivmedizin wenig ändert. Da gibt es leider zwei mitunter fatale Glaubenssätze: „Mich wird es schon nicht erwischen” und „Solange ich nichts von der Krankheit weiß, habe ich sie auch nicht.”

Mehr zum Thema Präventivmedizin und die Auswirkungen von Entzündungen auf unseren Körper erfährst du im Talk mit Univ. Prof. DI Dr. Johannes A. Schmid, Leiter des Instituts für Gefäßbiologie und Thromboseforschung an der Medizinischen Universität Wien.
Gibt es hierzulande bereits verpflichtende Ausbildungsinhalte zur Gendermedizin in der medizinischen Ausbildung?
Nein, in Österreich gibt es das nicht einheitlich. Das liegt daran, dass jede Universität ihr Curriculum selbst gestalten darf. Das führt dazu, dass es an manchen Standorten verpflichtende Lehrveranstaltungen zur Gendermedizin gibt, während es an anderen Universitäten gar nicht vorkommt. Früher gab es einmal die Idee, ein einheitliches Medizin-Curriculum zu schaffen, aber dann entschied man, den Universitäten mehr Autonomie zu geben – mit dem Effekt, dass sich Inhalte stark unterscheiden.
In Innsbruck haben wir es als Pflichtfach eingeführt. Ich habe damals gesagt: Entweder machen wir es verpflichtend oder gar nicht – halbe Sachen bringen nichts. Jetzt ist Gendermedizin hier im regulären Lehrplan ein verpflichtender Bestandteil, ebenso für den klinischen PHD und die Habilitation. Außerdem haben wir sichergestellt, dass Gendermedizin auch in andere Gesundheitsberufe einfließt. An der FH Gesundheit, wo Gesundheitsberufe akademisiert werden, ist es ebenfalls Teil der Ausbildung – etwa in der Röntgenassistenz, Physiotherapie, für Hebammen und andere Berufsgruppen. Auch in der Pflegeausbildung ist es mittlerweile integriert.
Auch in der Ärztefortbildung tut sich immer mehr etwas. Dieses Jahr finden wieder die Ärztetage in Grado statt und wir sind zum 16. Mal mit dabei. Hier finden eine Woche lang von morgens bis abends Vorträge und Weiterbildungen statt und die Gendermedizin ist ein Teil davon.
Wie gut ist die Datenlage zur Gendermedizin derzeit?
Da muss man zwei Dinge unterscheiden: Erstens, ob es überhaupt Daten gibt, und zweitens, ob man darauf zugreifen kann. In einigen Fachbereichen ist die Datenlage hervorragend. In der Kardiologie gibt es mittlerweile eine sehr gute wissenschaftliche Basis, weil man dort früher erkannt hat, dass es gravierende geschlechterspezifische Unterschiede gibt. Auch in den Neurowissenschaften hat sich in den letzten Jahren viel getan. Erinnern Sie sich an diese Studien, bei denen man gezeigt hat, wie unterschiedlich Hirnregionen bei Männern und Frauen auf Reize reagieren? Da gab es einmal ein berühmtes Experiment, bei dem Männern und Frauen unterschiedliche Bilder gezeigt wurden z. B. von Wurstsemmeln oder Erotikbildern und man sich angeschaut hat, welche Hirnregionen aktiviert werden. Das hat damals viel Aufsehen erregt, und durch diesen medialen Hype sind die Fördermittel für diesen Bereich regelrecht explodiert.
Ein weiteres Gebiet mit relativ guter Datenlage ist die Pharmakologie, aber hier gibt es eine große Einschränkung: Viele Daten sind schlichtweg nicht zugänglich. Forschung kostet Geld, und wenn man etwa in Österreich beim Wissenschaftsfonds FWF oder in Deutschland bei der DFG eine Studie beantragt, bekommt man oft zur Antwort: „Interessantes Thema, aber das sollte doch die Pharmaindustrie finanzieren.” Und wenn die Pharmaunternehmen dann tatsächlich Forschung finanzieren, gibt es einen Haken: Sie behalten die Daten oft für sich. Wer mit der Industrie zusammenarbeitet, muss oft eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben, und so verschwinden viele wichtige Erkenntnisse in den Schubladen der Unternehmen, anstatt der Allgemeinheit zur Verfügung zu stehen.
Das Problem ist, dass Pharmafirmen genau wissen, dass sie früher oder später gezwungen sein werden, geschlechtsspezifische Unterschiede bei Medikamenten zu berücksichtigen. Aber solange es nicht verpflichtend ist, verzögern sie es, weil jede Verzögerung Geld spart. Das bedeutet, dass wir theoretisch eine sehr gute Datenlage hätten, praktisch aber oft keinen Zugriff darauf haben.
Zusammenfassend kann man sagen: In der Kardiologie, in den Neurowissenschaften und mit Einschränkungen in der Pharmakologie gibt es viele Daten, aber in anderen Fachbereichen, wie etwa der Dermatologie, fehlen noch umfassende geschlechterspezifische Studien. Und selbst in den Bereichen, wo die Datenlage gut ist, bedeutet das noch lange nicht, dass dieses Wissen auch konsequent in die Praxis umgesetzt wird. Das ist eine der großen Herausforderungen der Gendermedizin.

Das wundert mich, gerade bei der Dermatologie, wo man doch weiß, dass Hautprobleme oft mit Dysbalancen im Hormonhaushalt zusammenhängen?
Ja, das ist in der Tat verwunderlich. Wir wissen schon lange, dass Frauen deutlich häufiger an Allergien leiden als Männer. Auch Nebenwirkungen von Medikamenten werden von Frauen viel öfter gemeldet. Aber genau das war lange Zeit ein Problem. Die Pharmaindustrie hat Frauen gezielt von Studien ausgeschlossen, weil sie „zu viele” Nebenwirkungen meldeten. Das hat dazu geführt, dass Medikamente primär an Männern getestet wurden und die Daten für Frauen schlicht fehlten.
Früher wurde viel darüber spekuliert, warum Frauen sensibler auf Medikamente reagieren. Da gab es dann lange psychologische Vorträge darüber, dass Frauen einfach ein anderes Körpergefühl haben oder sich intensiver mit ihren Beschwerden auseinandersetzen. Das wurde lange als „psychologisches Phänomen” abgetan. Viele von uns saßen in diesen Vorlesungen und dachten sich: „Ja, mag ja sein, aber da muss doch mehr dahinterstecken.”
Dann hat sich die Grundlagenforschung endlich weiterentwickelt. Heute wissen wir, dass das Immunsystem von Frauen und Männern grundsätzlich unterschiedlich reagiert, weil Hormone eine massive Rolle spielen. Östrogene stärken das Immunsystem, Testosteron schwächt es. Das hat Vor- und Nachteile: Frauen haben eine bessere körpereigene Abwehr gegen viele Infektionen, erkranken auch insgesamt seltener an Krebs und haben, wenn sie an Krebs erkranken, eine höhere Chance auf Heilung. Aber sie haben ein deutlich höheres Risiko für Autoimmunerkrankungen wie Lupus, das zu 90 Prozent Frauen betrifft. Auch Allergien treten bei Frauen wesentlich häufiger auf.
Diese immunologischen Unterschiede erklären also vieles, was man früher psychologisch zu erklären versuchte. Und genau deshalb müssen hier viele Fachbereiche dringend aufholen.
Wie wichtig ist es, dass klinische Studien geschlechtspezifisch ausgewertet werden?
Wie schon kurz erwähnt, wurden Frauen in klinischen Studien oft nicht berücksichtigt, weil man ihre Nebenwirkungsmeldungen als „zu kompliziert“ ansah oder weil hormonelle Schwankungen als Störfaktor betrachtet wurden. Das führte dazu, dass viele Medikamente primär an Männern getestet wurden – mit zum Teil fatalen Folgen für Frauen.
Heute hat sich das zum Glück geändert, vorallem weil die USA mit gutem Beispiel vorangegangen sind. Alles, was vom National Institutes of Health (NIH) finanziert wird, muss geschlechtsspezifische Daten enthalten. Wer das nicht liefert, bekommt schlicht kein Geld. In der EU dauert es etwas länger, aber auch hier ziehen die Förderinstitutionen nach. Das war jedoch kein freiwilliger Erkenntnisprozess, sondern wurde durch finanziellen Druck erzwungen: Forschungsgelder gibt es nur noch, wenn Daten nach Geschlecht getrennt analysiert und veröffentlicht werden.
Ein besonders großes Problem gab es in der Grundlagenforschung. Man hat dort lange nicht einmal das Geschlecht der Versuchstiere mit einbezogen. Mäuse-Studien wurden fast ausschließlich mit männlichen Tieren durchgeführt, was dazu führte, dass bereits auf dieser Ebene falsche Annahmen getroffen wurden. Ich erinnere mich auch an eine Diskussion mit einem Kinderarzt, der allen Ernstes meinte, dass es bei Kindern keine geschlechtsspezifischen Unterschiede gäbe. Dabei gibt es beinahe nirgendwo so große Unterschiede wie bei Kindern!
Es ist für die optimale Versorgung aller Patientinnen und Patienten essentiell, dass Studien geschlechterübergreifend und die Daten geschlechtsspezifisch ausgewertet werden.
Wie steht es um die Erfassung von Gesundheitsdaten für diverse Bevölkerungsgruppen, insbesondere LGBTIQ+-Personen?
Die Frauengesundheitsbewegung hat zwischenzeitlich erreicht, dass alle Gesundheitsdaten, Gesundheitsberichte gegendert sind, d.h. alle Daten werden für Frauen und Männer getrennt ausgewiesen, aber es gibt keinerlei Daten zu LGBTIQ+ Personen. Die Gesundheitsdaten sind hier eine große Baustelle. In Österreich gibt es inzwischen zumindest einen LGBTIQ+-Gesundheitsbericht, was ein Fortschritt ist, aber die Datenbasis ist sehr dünn. Es gibt zwar kleinere Studien, aber diese beruhen oft auf winzigen Stichproben von Personen, die sich aktiv an Vereinen oder Interessengruppen beteiligen. Das ist hochgradig selektiv und sagt wenig über die Gesamtbevölkerung aus.
Gibt es spezielle medizinische Anlaufstellen für trans* Personen in Österreich?
Ja, jedes Bundesland ist verpflichtet, eine Anlaufstelle für trans* Personen in einem Landeskrankenhaus einzurichten. Dort soll es Beratung, psychologische Betreuung, Hormontherapie und gegebenenfalls operative Eingriffe geben. Nicht jede Klinik bietet alles an, aber zumindest die Beratung und die Weitervermittlung müssen gewährleistet sein. Grundsätzlich funktioniert dieses System, aber es gibt noch Lücken, insbesondere was die Langzeitversorgung betrifft.
Wie sieht es in diesem Zusammenhang z. B. mit der medizinischen Forschung zu den gesundheitlichen Langzeitfolgen einer Hormontherapie für trans* Personen aus?
Hier gibt es große Wissenslücken. Wir wissen, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, dass Hormone wie Testosteron und Östrogen massive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System haben. Östrogene scheinen schützend zu wirken, während Testosteron das Risiko für Bluthochdruck erhöht. Aber es gibt keine Langzeitstudien darüber, was eine jahrzehntelange Hormontherapie für trans* Personen bedeutet. Wir haben zwar Daten von Frauen, die über Jahrzehnte hormonelle Kontrazeptiva oder Hormonersatztherapie bei Wechselbeschwerden genommen haben, aber das lässt sich nicht eins zu eins übertragen. Zu Dauertestosteronbehandlungen gibt es keine vergleichbaren Studien. Auch für Bluthochdruck gibt es keine speziellen Empfehlungen für trans* Personen, die Testosteron nehmen. Das zeigt, wie groß der Forschungsbedarf ist.
Wie sieht es mit der medizinischen Versorgung von intergeschlechtlichen Personen aus?
Intergeschlechtliche Personen werden medizinisch oft übersehen. Sie haben meist keine spezifischen Anlaufstellen und müssen sich selbst durch das Gesundheitssystem navigieren. Viele werden als Kinder medizinisch betreut, weil Eltern und Ärztinnen und Ärzte eine Geschlechtszuordnung für das Geburtenregister vornehmen müssen. Aber im Erwachsenenalter gibt es kaum spezialisierte Angebote, was ein großes Problem ist.
„Ein riesiges Problem ist, dass klinische Studien fast ausschließlich in westlichen Industrieländern durchgeführt werden. Selbst wenn wir jetzt Frauen stärker einbeziehen, testen wir Medikamente immer noch nur an einem winzigen Teil der Weltbevölkerung.”
Generell gefragt: Wie divers und inklusiv sind klinische Studien wirklich?
Ein riesiges Problem ist, dass klinische Studien fast ausschließlich in westlichen Industrieländern durchgeführt werden, wo der Großteil der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer Menschen aus Industrieländern sind. Selbst wenn wir jetzt Frauen stärker einbeziehen, testen wir Medikamente immer noch nur an einem winzigen Teil der Weltbevölkerung. Menschen aus Regionen wie Bangladesch oder der Elfenbeinküste sind in diesen Studien fast nie vertreten.
Es gibt auch große ethnische Unterschiede in der Medikamentenwirksamkeit. Ein bekanntes Beispiel sind Studien zu ACE-Hemmern zur Behandlung von Bluthochdruck in den USA, die bei vielen Afroamerikanerinnen und -amerikanern schlechter wirken. Lange Zeit hieß es, das liege daran, dass diese Patientengruppe sich Medikamente nicht leisten könne oder sie unregelmäßig einnehme. Erst als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darauf hinwiesen, dass es biologische Gründe geben könnte, wurde das ernsthaft untersucht. Heute wissen wir, dass diese Medikamente bei afrikanischstämmigen Bevölkerungsgruppen tatsächlich weniger wirksam sind.
Wie beeinflussen kulturelle und ethnische Unterschiede die Gesundheitsforschung?
In vielen Studien werden Bevölkerungsgruppen und ethnische Hintergründe nicht differenziert genug erfasst. So spricht man zum Beispiel von „asiatic“, aber das umfasst China, Vietnam, Japan etc. – unterschiedliche Länder mit Bevölkerungen mit völlig unterschiedlichen genetischen Hintergründen. Ähnlich ist es bei „hispanics”. Ein Begriff, der in Wahrheit eine sehr heterogene Gruppe umfasst. Solche Vereinfachungen führen dazu, dass Medikamente und Therapien nicht optimal angepasst werden.
Welche weiteren Herausforderungen gibt es bei der globalen Gesundheitsforschung?
Viele Krankheiten sind in ärmeren Ländern viel zu wenig erforscht, weil dort die Infrastruktur für Studien fehlt. Impfungen, sauberes Trinkwasser und einfache Präventionsmaßnahmen könnten viele dieser Probleme lösen, aber oft fehlen die Mittel. Zudem sterben viele Menschen in diesen Regionen sehr früh an Infektionskrankheiten.
Diese Themen werden in der Forschung oft ignoriert, weil sich alles auf die reichen Industrieländer konzentriert. Solange wir diese Wissenslücken nicht schließen, bleibt die Medizin in vielen Bereichen unausgewogen.
Wie sieht es mit dem Bewusstsein der Patientinnen und Patienten aus?
Gerade bei Medikamenten wächst das Bewusstsein, dass sie bei Frauen und Männern unterschiedlich wirken können. Viele Patientinnen fragen mittlerweile gezielt nach, ob ihre Medikamente geschlechtsspezifisch dosiert sind. Das zeigt, dass sich das Wissen langsam verbreitet. Gendermedizin sollte aber nicht nur passieren, wenn sie von den Patientinnen und Patienten eingefordert wird – sie muss selbstverständlicher Teil der medizinischen Praxis sein.
Als erster Schritt, um Bewusstsein zu schaffen: Inwieweit können Patientinnen und Patienten selbst auf geschlechtersensible Behandlung achten?
Das Wichtigste ist, sich selbst gut zu informieren und bei Ärztinnen und Ärzten gezielt nachzufragen. Ich rate Patientinnen immer, sich nicht mit vagen Diagnosen wie „Stress“ oder „psychosomatisch“ abspeisen zu lassen, wenn sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt. Ein weiterer wichtiger Punkt: Frauen sollten sich ihrer Rechte bewusst sein. Inzwischen gibt es immer mehr Informationen zu geschlechtersensibler Medizin, und es lohnt sich, gezielt nach Kliniken oder Ärztinnen und Ärzten zu suchen, die in diesem Bereich weitergebildet sind.
Eine spezielle Frage an Sie als Kardiologin: Warum werden Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen oft zu spät erkannt?
Das größte Problem ist, dass Frauen Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht als ihr Hauptgesundheitsrisiko wahrnehmen. Während Männer oft wissen, dass ihr Herz irgendwann Probleme machen könnte, denken viele Frauen, ihr größtes Risiko sei Brustkrebs – obwohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen viel häufiger zum Tod führen. Etwa zehnmal so viele Frauen sterben jährlich einen Herz-Kreislauf-Tod im Vergleich zu Brustkrebs. Oft erkennen nicht einmal Frauen mit einer familiären Vorgeschichte, dass sie gefährdet sein könnten.
Ein weiteres Problem ist die Art, wie Frauen ihre Symptome beschreiben. Männer kommen oft zum Arzt und sagen direkt: „Meine Pumpe macht Probleme.“ Frauen hingegen äußern eher allgemeine Beschwerden wie Müdigkeit, Erschöpfung oder ein diffuses Unwohlsein. In vielen Fällen werden diese Symptome dann als Wechseljahresbeschwerden oder Stress abgetan. Dadurch kann es passieren, dass ernsthafte Herzprobleme übersehen werden.
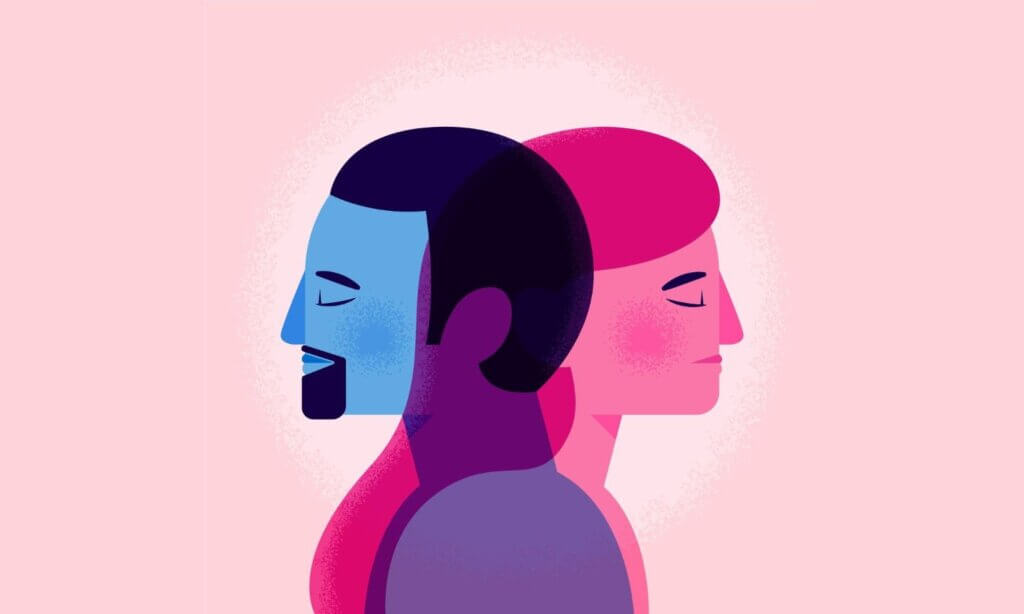
Gibt es Unterschiede in den Symptomen eines Herzinfarkts zwischen Männern und Frauen?
Ja, es gibt die sogenannten atypischen Symptome bei Frauen. Während Männer häufig das klassische Druckgefühl auf der Brust haben, äußert sich ein Herzinfarkt bei Frauen oft durch atypische Symptome wie Übelkeit, Rückenschmerzen oder Kurzatmigkeit. Das führt dazu, dass Herzinfarkte bei Frauen oft nicht sofort erkannt werden. Das ist einer der Gründe. Generell ist die koronare Herzerkrankung nach wie vor männlich besetzt.
Ein weiteres Problem ist, dass Frauenherzen anatomisch anders sind als Männerherzen. Frauen haben kleinere Koronararterien und feinere Gefäße, was bedeutet, dass Verkalkungen oft nicht so leicht mit Stents behandelt werden können. Zudem neigen Frauen eher zu Gefäßveränderungen in den kleineren Arterien, die schwieriger zu diagnostizieren und zu therapieren sind.
Gibt es spezielle Therapieansätze für Frauen?
Ja, aber sie werden nicht immer konsequent angewendet. Zum Beispiel wurden Stents anfangs in einer Einheitsgröße entwickelt, die oft für Frauen zu groß war und dadurch Probleme verursachten. Inzwischen gibt es spezielle Stents für Frauen.
Ein weiteres Beispiel sind Cholesterinsenker. Obwohl es klare Daten gibt, dass Frauen genauso von Cholesterinsenkern profitieren wie Männer, werden sie ihnen seltener verschrieben. Das liegt unter anderem daran, dass Frauen tendenziell häufiger Nebenwirkungen melden, was zu einer Zurückhaltung in der Verschreibung führt, aber da es immer mehr verschiedene Präparate gibt, sollte für jede Frau ein geeignetes Medikament gefunden werden.
Wir hatten bereits vorhin kurz das Thema der Dosierung von Medikamenten angesprochen: Gibt es Medikamente, die bei Frauen anders wirken als bei Männern?
Ja, eines der bekanntesten Beispiele ist das Schlafmittel Zolpidem. In den USA war es lange das meistverkaufte Schlafmittel. Nachdem auffällig viele Frauen am Morgen nach der Einnahme Unfälle hatten, wurde die Dosierung untersucht. Die Studien zeigten, dass Frauen das Medikament langsamer abbauen. Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA passte daraufhin die Empfehlung an: Frauen sollten nur die halbe Dosis nehmen. Trotzdem werden in Österreich und Deutschland nach wie vor oft die gleichen Dosierungen für Männer und Frauen verschrieben.
Ähnlich verhält es sich mit Blutdruckmedikamenten: Manche Wirkstoffe lösen bei Frauen häufiger Nebenwirkungen wie geschwollene Beine oder trockenen Husten aus. Trotzdem werden sie oft ohne Differenzierung verordnet.
Auch bei Belastungs-EKGs zeigt sich, dass Gendermedizin oft ignoriert wird. Diese Methode funktioniert bei Männern hervorragend zur Diagnose von koronaren Herzerkrankungen, ist aber bei Frauen viel weniger zuverlässig. Trotzdem wird sie immer noch routinemäßig eingesetzt. Dabei gibt es inzwischen bessere Alternativen, wie das Koronar-CT und MRTs, die genauere Ergebnisse liefern.
Auch in der Krebstherapie gibt es Unterschiede. Männer profitieren beispielsweise stärker von bestimmten Immuntherapien, während Frauen oft eine andere Reaktion auf Chemotherapien zeigen.
Warum werden diese oftmals bereits seit Jahren bekannten Unterschiede immer noch so oft ignoriert?
Ein Grund dafür ist, dass sich Veränderungen in der medizinischen Praxis nur langsam durchsetzen. Um Gendermedizin wirklich in der Routine zu verankern, ist es wichtig, sie von Anfang an in die medizinische Ausbildung zu integrieren. In Innsbruck haben wir das so gelöst, dass sie in die Semesterprüfungen eingebaut ist. Studierende lernen das Thema früh und ganz selbstverständlich als Teil ihrer medizinischen Ausbildung kennen – so wird es zur Normalität.
Haben sich Diskrepanzen aufgrund fehlender genderspezifischer Medizin auch in der Covid-19-Pandemie gezeigt?
Ja, die Pandemie hat viele Probleme in diesem Bereich offengelegt. Hier war beispielsweise wieder der Umstand, dass Frauen ein stärkeres Immunsystem haben und bei Infektionskrankheiten generell besser abschneiden als Männer, klar zu sehen. Trotzdem wurde zu Beginn der Pandemie fast ausschließlich auf das Risiko von alten Frauen hingewiesen. Als dann herauskam, dass mehr Männer an COVID-19 sterben als Frauen, war das für viele überraschend – obwohl die Datenlage dazu schon vorher existierte.
Ein weiteres großes Problem war der Umgang mit Impfungen. Es gab schon jahrelang Überlegungen, ob Frauen wegen ihres meist geringeren Körpergewichts generell möglicherweise eine niedrigere Impfdosis benötigen könnten. Diese Diskussion wurde aber nie ernsthaft geführt, obwohl man so mit der gleichen Menge Impfstoff doppelt so viele Frauen hätte impfen können.
Besonders schlimm fand ich den Umgang mit Schwangeren. Lange Zeit wusste niemand genau, wie sich eine Impfung während der Schwangerschaft auswirken könnte. Anstatt rasch belastbare Daten zu sammeln – was angesichts der hohen Geburtenzahlen in Europa leicht möglich gewesen wäre – ließ man Frauen monatelang in Unsicherheit. Das zeigt, wie wenig auf die Bedürfnisse von Frauen in der Medizin geachtet wird.
„Die Medizin wird immer mehr weiblich. Das lässt sich nicht mehr aufhalten – und das ist gut so.“
Diskrepanzen gibt es nicht nur bei allgemeinen Gesundheitsthemen: Warum werden frauenspezifische Erkrankungen wie Endometriose oft spät diagnostiziert und wenig erforscht?
Es gibt mehrere Gründe dafür. Zum einen folgen medizinische Themen oft bestimmten „Moden“. Aktuell bekommt die Endometriose endlich mehr Aufmerksamkeit, es gibt aber noch zahlreiche andere Erkrankungen, die nach wie vor oft übersehen werden.
Zum anderen werden viele Beschwerden von Frauen – insbesondere solche, die mit dem Zyklus zusammenhängen – nicht ernst genommen. Schmerzen oder Unwohlsein werden oft als normale Begleiterscheinungen der Menstruation oder der Wechseljahre abgetan. Dadurch verzögert sich die Diagnose erheblich, obwohl viele Frauen jahrelang unter starken Beschwerden leiden.
Ein weiteres Problem ist, dass frauenspezifische Themen in der Medizin oft nicht ausreichend diskutiert werden. Besonders in männlich dominierten Fachrichtungen gibt es eine gewisse Abwehrhaltung gegenüber gynäkologischen Themen und den körperlichen Funktionen von Frauen. Viele Beschwerden werden schnell als „hysterisch“ oder „psychosomatisch“ abgetan, was dazu führt, dass betroffene Frauen lange Zeit keine angemessene medizinische Betreuung erhalten.
Wenn Sie an die Zukunft denken – welche Entwicklungen und strukturellen Veränderungen wünschen Sie sich für die Gendermedizin? Und welche Trends sehen Sie?
Ich sehe durchaus Fortschritte, aber auch Rückschritte. Ein großes Problem ist, dass Gendermedizin zunehmend in den Händen von Nicht-Medizinern liegt. Ich wünsche mir, dass das Fach wieder stärker in der Medizin selbst verankert wird – in Forschung, Lehre und Praxis. Wir müssen zudem darauf achten, dass sich die unterschiedlichen Interessengemeinschaften, die noch nicht den Raum haben, den sie verdient hätten, nicht gegenseitig zerfleischen. Das ist natürlich ein Umstand, der von “Alteingesessenen” und jenen, die keine Veränderungen in diese Richtung möchten, auch gerne befeuert wird. Nach dem Motto: Ihr bekommt ein kleines Stück vom Kuchen und jetzt prügelt euch untereinander darum. Es geht darum, dass neuer Raum für mehr Diversität in der Medizin geschaffen wird. Dafür müssen aber die “Alteingesessenen” immer weiter etwas von der Torte hergeben und nicht jene, die sich in mühsamer Kleinarbeit ein Stück davon erkämpft haben.
Ein Hoffnungsschimmer im Bereich der Gendermedizin sind für mich die Patientinnen selbst. Frauen hinterfragen heute viel mehr, ob ein Medikament für sie überhaupt getestet wurde oder ob ihre Symptome ernst genommen werden. Sie suchen nach Informationen, lesen Studien und lassen sich nicht mehr so leicht abspeisen. Wenn Frauen Druck machen, ziehen Medien und Politik nach.
Ich bin optimistisch, aber nicht naiv. Nichts ist in Stein gemeißelt. Man sieht es an Ländern wie den Niederlanden oder Schweden, die mal Vorreiter in der Frauenförderung waren und dann plötzlich Mittel gekürzt haben. Auch der politische Rechtsruck in Europa und den USA ist absolut nicht hilfreich. Aber ich glaube nicht, dass man die ganzen Förderrichtlinien für Forschung so schnell über den Haufen werfen kann – zumindest in Europa nicht. Die EU-Maschinerie ist träge – zum Glück manchmal. Die Medizin wird außerdem immer weiblicher. In Deutschland sind bereits 70 Prozent der Medizinstudierenden Frauen, in Österreich liegt der Anteil auch schon über der Hälfte. Das kann man nicht mehr aufhalten.
Header © beigestellt




